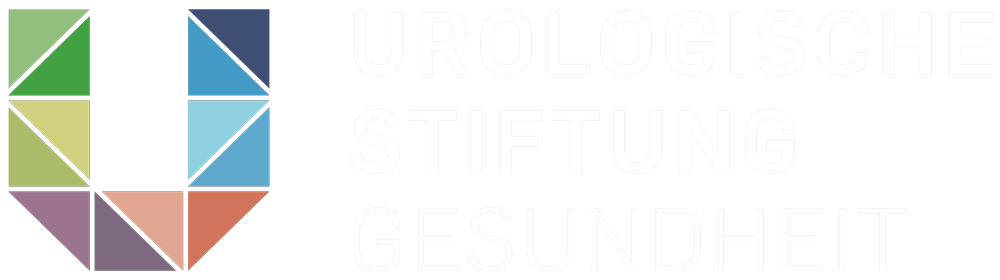Das sollten Sie über Harnsteine wissen
In den vergangenen Jahren ist die Häufigkeit von Harnsteinerkrankungen in den westlich geprägten Industrienationen deutlich angestiegen. Besonders in Deutschland zeigt sich ein alarmierender Trend: Die Anzahl der Neuerkrankungen hat sich innerhalb der letzten zehn Jahre verdreifacht. Heute ist fast jeder 20. Deutsche mindestens einmal im Leben betroffen – teils sogar mehrfach. Jährlich benötigen etwa 1,2 Millionen Menschen in Deutschland eine Behandlung wegen Harnsteinen.
Harnsteine können sich im gesamten Harntrakt bilden. Je nach Lage spricht man von Nierensteinen, Harnleitersteinen oder Blasensteinen. Während Blasensteine häufig durch Probleme bei der Blasenentleerung entstehen, werden Nieren- und Harnleitersteine oft durch ungünstige Ernährungsgewohnheiten, genetische Veranlagung oder Stoffwechselstörungen ausgelöst.
Ein wesentlicher Grund für die steigende Zahl von Harnsteinerkrankungen in den westlichen Industrieländern ist die zunehmende Übergewichtigkeit der Bevölkerung. Übergewicht geht häufig mit weiteren gesundheitlichen Problemen einher, wie Bluthochdruck, Diabetes mellitus und Fettstoffwechselstörungen – zusammen bekannt als metabolisches Syndrom.
Typische Beschwerden bei Harnsteinen
Nierensteine verursachen anfangs meist keine Beschwerden. Selbst größere Steine, sogenannte Ausgusssteine, bleiben oft unbemerkt. Sobald jedoch ein Stein oder ein Bruchstück aus dem Nierenbecken in den engeren Harnleiter gelangt, treten meist starke Schmerzen durch eine Harnabflussstörung auf. Diese Harnstauung verursacht die charakteristischen Nierenkoliken.
Beim Besuch beim Urologen wird nach einer ersten Schmerzbehandlung mittels Ultraschall- und Röntgenuntersuchung und ggf. Conmputertomografie die Größe und Lage des Steins festgestellt. Auf Basis dieser Diagnose bespricht der Urologe die möglichen Therapieoptionen – von abwartendem Beobachten bis hin zu operativen Eingriffen.
Was sind Harnsteine genau?
Harnsteine sind Kristallablagerungen, die sich in den Nieren bilden. Am häufigsten bestehen sie aus Kalziumoxalat, welches etwa 70 % aller Harnsteine ausmacht. Weitere Bestandteile können sein: Harnsäure, Kalziumphosphat, Magnesium-Ammonium-Phosphat oder selten Cystin.
Wie entstehen Harnsteine?
Die Entstehung von Harnsteinen kann durch verschiedene Faktoren begünstigt werden, wie z. B.:
- Falsche Ernährung und Übergewicht
- Zu geringe Flüssigkeitszufuhr, insbesondere bei hoher Temperatur oder körperlicher Anstrengung
- Harnwegsinfektionen
- Stoffwechselstörungen, etwa eine Überfunktion der Nebenschilddrüse
- Abflussbehinderungen oder anatomische Besonderheiten im Harntrakt (z. B. Verengungen des Nierenbeckens)
- Genetische Stoffwechselerkrankungen wie Zystinurie
Symptome eines Harnsteinleidens
Seine, die in der Niere liegen, bleiben oft unbemerkt oder verursachen nur diffuse Beschwerden wie ein leichtes Ziehen in der Flanke.
Bei Harnleitersteinen, die aus der Niere in den Harnleiter abgegangen sind, treten dagegen typischerweise starke Koliken auf. Diese äußern sich als plötzlich einsetzende, sehr starke Schmerzen, die intervallartig kommen und gehen. Je nach Lage des Steins können die Schmerzen in der Flanke, der Leiste, dem Unterbauch oder im Bereich des Hodens bzw. der Schamlippen auftreten. Häufig besteht auch ein verstärkter Harndrang.
Zusätzlich kann der Urin durch Blutbeimengungen eine rötliche Färbung aufweisen. Liegt eine begleitende Harnwegsinfektion vor, treten oft Brennen beim Wasserlassen oder sogar Fieber auf.
Untersuchung zur Diagnose von Harnsteinen
Der erste Schritt zur Diagnose ist die Anamnese. Der Urologe fragt nach der Krankheitsgeschichte, inklusive der Familiengeschichte, da Harnsteine auch vererbt werden können. Ernährungsgewohnheiten und Lebensumstände liefern ebenfalls wichtige Hinweise.
Nach der Anamnese folgt die körperliche Untersuchung. Ein Druckschmerz in der Flanke kann auf einen Harnstau hinweisen. Zudem wird der Urin untersucht, häufig finden sich rote Blutkörperchen. Im Blut werden Werte wie Harnsäure, Kalzium und Kreatinin überprüft.
Bildgebende Untersuchungen
Eine Ultraschalluntersuchung (Sonographie) liefert Hinweise auf die Lage der Steine und mögliche Harnabflussstörungen. Ergänzend können Röntgenuntersuchungen wie eine Leeraufnahme, seltener eine Ausscheidungsurographie durchgeführt werden, bei der ein Kontrastmittel über die Vene verabreicht wird. Stattdessen ermöglicht eine Computertomographie ohne Kontrastmittel (Nativ-CT) eine besonders genaue Beurteilung der Steine.
Können Harnsteine von selbst abgehen?
In etwa 80 % der Fälle scheiden sich Harnsteine auf natürlichem Weg über die ableitenden Harnwege aus, wenn sie klein (bis etwa 5mm) sind. Mit krampf- und schmerzlösenden Medikamenten kann dieser Prozess unterstützt werden. Bleibt ein Stein jedoch stecken, wird der Urologe eine weitere Behandlung einleiten, um Komplikationen zu vermeiden.
Notfall: Schwere Kolik
Eine akute Nierenkolik ist ein medizinischer Notfall und erfordert sofortige Behandlung. Zunächst wird eine Schmerztherapie durchgeführt. Im Anschluss folgen weiterführende Untersuchungen, um die bestmögliche Therapie individuell festzulegen.
Behandlungsmöglichkeiten bei Harnsteinen
Folgende Behandlungsmöglichkeiten stehen zur Verfügung
- Medikamentöse Unterstützung und Flüssigkeitszufuhr:
Mit einer ausreichenden Trinkmenge und medikamentöser Unterstützung können Harnsteine häufig spontan ausgeschieden werden. Körperliche Bewegung kann den Prozess zusätzlich fördern. - Chemolitholyse – Auflösen der Harnsteine durch Medikamente:
Diese Methode ist besonders bei Harnsäuresteinen erfolgreich. Die medikamentöse Litholyse eignet sich jedoch nicht für alle Steinzusammensetzungen. - Extrakorporale Stoßwellen-Lithotripsie (ESWL):
Mit fokussierten Energiewellen werden die Harnsteine von außen zertrümmert. Der Eingriff erfolgt in der Regel ambulant und ohne Narkose. Sowohl Nierensteine als auch Harnleitersteine können auf diese Weise behandelt werden.
Größere Steine können jedoch nach der Zertrümmerung den Harnleiter blockieren und Koliken verursachen, wodurch unter Umständen weitere Maßnahmen wie die Anlage einer Harnleiterschiene oder eine Ureterorenoskopie (URS) notwendig werden. In seltenen Fällen treten größere Blutergüsse im Bereich der Nieren auf. - Anlage einer Harnleiterschiene:
Verlegt ein Harnleiterstein den Harnleiter vollständig, sodass kein Urinabfluss mehr möglich ist, kann eine Harnleiterschiene erforderlich werden. Diese besteht aus einem dünnen Kunststoffschlauch, der im Rahmen einer Blasenspiegelung in die Niere eingeführt wird. Ziel ist es, die Nierenfunktion zu schützen und die durch den Stein verursachte Engstelle zu überbrücken. - Perkutane Nephrolitholapaxie (PNL):
Über die Körperaußenseite wird ein dünner Kanal mithilfe einer Punktionsnadel bis zur Niere angelegt. Durch diesen Kanal wird ein optisches Instrument eingeführt, mit dem der Urologe größere Nierensteine zerkleinern und entfernen kann.
Diese Methode wird bevorzugt bei größeren Nierensteinen angewendet, da sie eine schnelle und vollständige Entfernung ermöglicht. Nachteilig ist jedoch eine erhöhte Blutungsneigung sowie das Risiko der Verletzung benachbarter Organe. Harnleitersteine können mit der PNL nicht behandelt werden. - Ureterorenoskopie (URS):
Ein Endoskop wird durch die Harnröhre in den Harnleiter bis ins Nierenbecken eingeführt. Mit dieser Methode können Steine aus dem Harnleiter oder Nierenbecken entfernt werden. Größere Steine lassen sich zuvor mit einem Laser zerkleinern.
Die URS ermöglicht eine schnelle und vollständige Entfernung von Harnleitersteinen sowie kleineren Nierensteinen. Bei sehr großen Steinen ist jedoch die PNL das bevorzugte Verfahren. Zu den Risiken zählen mögliche Verletzungen des Harnleiters durch das Instrument oder narbige Verengungen der Harnwege. Nach der Behandlung wird häufig eine Harnleiterschiene eingelegt. - Offene Operation:
Dieser Eingriff wird nur noch selten durchgeführt und vor allem bei anatomischen Besonderheiten oder sehr großen Nierensteinen angewendet. Minimal-invasive Verfahren haben die offene Operation heutzutage nahezu vollständig ersetzt.
Individuelle Therapieplanung
Die Wahl der Behandlung hängt von der Lokalisation, der chemischen Zusammensetzung sowie dem Ausmaß des Steinleidens ab. Nach einer ausführlichen Beratung legt der Urologe die passende Therapie gemeinsam mit dem Patienten individuell fest.
Vorbeugung gegen Harnsteine
Ohne eine geeignete Nachsorge erleiden etwa 50 % der Harnstein-Patienten mindestens ein Steinrezidiv, also eine erneute Steinbildung. Bei bis zu 25 % der Betroffenen treten sogar drei oder mehr Rückfälle auf.
Trink- und Ernährungsanpassungen
Eine signifikante Senkung des Risikos erneuter Harnsteine kann durch die Anpassung von Trink- und Ernährungsgewohnheiten erreicht werden. Wichtig ist, dass die Urinproduktion mindestens zwei Liter pro Tag beträgt.
Empfehlungen zur Prävention:
- Ausreichend trinken, idealerweise 2–3 Liter Wasser pro Tag.
- Eine ausgewogene Ernährung befolgen, Übergewicht reduzieren und sich regelmäßig körperlich betätigen.
Nach der Entfernung von Harnsteinen sollte eine Harnsteinanalyse durchgeführt werden. Die chemische Zusammensetzung der Steine liefert wichtige Informationen für eine gezielte Prävention.
Die häufigsten Steinzusammensetzungen
- Kalziumoxalat-Steine (70–75 %):
Die häufigste Art von Harnsteinen entsteht durch eine Vielzahl von Faktoren, weshalb die Entstehung als multifaktoriell gilt.
Prävention: Eine Reduktion oxalatreicher Lebensmittel wie Rhabarber, schwarzer Tee, Spinat, Kakao und Nüsse wird empfohlen. - Harnsäure-Steine (ca. 10 %):
Die Bildung dieser Steine wird durch eine purin- und proteinreiche Ernährung gefördert, die den Harn ansäuert. Harnsäure ist ein Endprodukt des Purinstoffwechsels und wird über die Nieren ausgeschieden.
Prävention: Gewichtsreduktion, eine Ernährungsumstellung mit weniger rotem Fleisch und die Alkalisierung des Urins durch Medikamente können das Risiko deutlich senken. - Infekt-Steine:
Diese Steine entstehen bei Harnwegsinfekten und waren früher oft die Ursache für große Ausgusssteine. Durch Frühdiagnostik und Antibiotika sind Infekt-Steine heute deutlich seltener.
Prävention: Eine vollständige Steinentfernung und konsequente Infektprophylaxe sind entscheidend. - Zystin-Steine:
Zystinsteine entstehen aufgrund der Zystinurie, einer genetischen Stoffwechselerkrankung. Ohne Behandlung kann diese zu einem Nierenversagen und Dialysepflicht führen. Sehr wichtig ist daher eine engmaschige urologische Betreuung. Hierbei werden zur Therapiekontrolle regelmäßige Untersuchungen eines 24h Sammelurin durchgeführt.
Prävention: Betroffene sollten eine Trinkmenge von 4–7 Litern täglich einhalten und tierisches Eiweiß reduzieren. Oft ist zusätzlich eine medikamentöse Therapie notwendig.
Häufige Fragen zu Harnsteinen
Was sollte ich essen, um Harnsteinen vorzubeugen?
Eine ausgewogene Ernährung mit weniger tierischem Eiweiß, weniger Salz und mehr Obst und Gemüse kann helfen, Harnsteine zu vermeiden. Außerdem ist es wichtig, ausreichend zu trinken – idealerweise 2 bis 3 Liter Wasser pro Tag.
Wie erkenne ich, ob ich Harnsteine habe?
Häufig bleiben Harnsteine zunächst unbemerkt. Symptome wie starke Schmerzen in der Flanke, rötlicher Urin oder Harndrang können jedoch auf Harnsteine hinweisen.
Kann ich Harnsteine ohne Operation behandeln?
Ja, in vielen Fällen gehen Harnsteine von selbst ab. Mit Medikamenten und ausreichender Flüssigkeitszufuhr lässt sich der Prozess oft beschleunigen. Bei größeren Steinen, die nicht von selbst abgehen können, und bei Komplikationen ist ein Eingriff nötig.