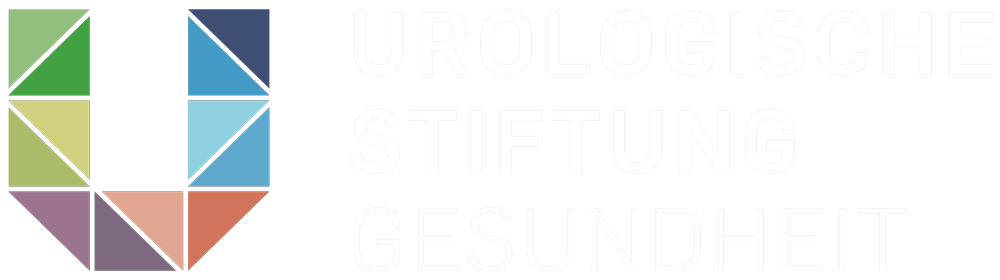BESSER LEBEN
Besser leben bei wiederholter Nierensteinbildung
Diese Empfehlungen helfen Ihnen im Alltag
Wie kann ich Nierensteinen vorbeugen?
Ein entscheidender Faktor bei der Vorbeugung von Nierensteinen ist eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr. Patienten sollten täglich mindestens zwei bis drei Liter Wasser trinken. Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr hilft, den Urin zu verdünnen, wodurch die Konzentration von Mineralien und Substanzen, die zur Steinbildung führen, verringert wird. Es ist wichtig, über den Tag verteilt regelmäßig zu trinken und die Flüssigkeitsaufnahme bei körperlicher Aktivität oder heißen Wetterbedingungen zu erhöhen. Getränke wie Kaffee, Tee und Alkohol sollten nur in Maßen konsumiert werden.
Die Ernährung spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Vorbeugung von Nierensteinen. Eine ausgewogene Ernährung mit einem hohen Anteil an Ballaststoffen und einem moderaten Gehalt an tierischem Eiweiß kann das Risiko der Steinbildung reduzieren. Ein übermäßiger Verzehr von tierischem Eiweiß, wie Fleisch und Fisch, erhöht die Ausscheidung von Kalzium und Harnsäure, was zur Bildung von Nierensteinen beitragen kann. Daher wird empfohlen, den Konsum dieser Lebensmittel zu begrenzen.
Oxalatreiche Lebensmittel und ihre Rolle bei der Nierensteinbildung
Oxalatreiche Lebensmittel wie Spinat, Rhabarber, rote Beete, Schokolade und Nüsse sollten ebenfalls in Maßen konsumiert werden, da Oxalat ein häufiger Bestandteil von Nierensteinen ist. Eine Ernährungsumstellung kann helfen, die Aufnahme von Oxalat zu reduzieren und das Risiko der Steinbildung zu minimieren.
Weil die Bildung von Nierensteinen oft ein Stoffwechselproblem ist, sollte ein Übergewicht reduziert und Normalgewicht angestrebt werden.

Die Bedeutung der Salzaufnahme bei Nierensteinen
Salz ist ein weiterer wichtiger Faktor, der bei der Vorbeugung von Nierensteinen berücksichtigt werden sollte. Eine hohe Salzaufnahme kann die Kalziumausscheidung im Urin erhöhen, was zur Bildung von Kalziumsteinen führt. Patienten sollten darauf achten, ihren Salzkonsum zu begrenzen und verarbeitete Lebensmittel zu vermeiden, die oft große Mengen an Salz enthalten. Stattdessen sollten sie auf eine natriumarme Ernährung achten, um das Risiko für Nierensteine zu senken.

Gesunder Lebensstil zur Reduktion von Nierensteinrisiken
Ein gesunder Lebensstil kann ebenfalls dazu beitragen, das Risiko für wiederholte Nierensteine zu reduzieren. Regelmäßige körperliche Aktivität fördert die allgemeine Gesundheit und hilft, Übergewicht zu vermeiden, das ein Risikofaktor für Nierensteine darstellt. Zudem sollten Patienten ihren Blutdruck und Blutzuckerspiegel im Normalbereich halten, da Bluthochdruck und Diabetes das Risiko für Nierensteine erhöhen können.
Patienten sollten ihre Medikamenteneinnahme mit ihrem Arzt besprechen, da einige Medikamente das Risiko von Nierensteinen erhöhen können. Dazu gehören Entwässerungsmittel, die den Kalziumspiegel im Urin erhöhen, sowie bestimmte Medikamente gegen Magensäure und Kalziumpräparate. In solchen Fällen kann der Arzt alternative Medikamente verschreiben oder zusätzliche Maßnahmen empfehlen, um das Risiko zu minimieren.
Symptome und Verlauf einer Nierenkolik
Die Schmerzen einer Nierenkolik beginnen meist im Rücken auf der Seite des Steines und können bei Wanderung eines Steines dann über den Bauch bis in Hoden oder Schamlippen ausstrahlen. Die Schmerzen sind meist wellenartig und schwellen an und ab. Häufig kommen Übelkeit bis zum Erbrechen hinzu. Wenn ein wandernder Stein den unteren Teil des Harnleiters vor der Blase erreicht hat, kann ein heftiger Harndrang hinzukommen. Durch den abgehenden Stein staut sich der Urin im Harnleiter bis zur Niere zurück. Wenn Fieber hinzukommt, spricht dies dafür, dass sich der durch den Stein gestaute Urin durch Bakterien entzündet hat. Dies ist eine gefährliche Situation, und Sie sollten unbedingt sofort einen Urologen oder eine Urologin konsultieren. Wenn der Stein die Blase erreicht hat, tritt meist Schmerzfreiheit ein.
Weil die Harnröhre, die den Urin aus der Blase heraus transportiert, einen größeren Durchmesser hat als der Harnleiter, durch den der Stein in die Blase gelangt ist, geht ein Stein, der die Blase erreicht hat, meist schmerzlos und ohne Behinderung aus der Blase ab. Während und nach einer Nierenkolik sollten Sie den Urin immer durch ein Sieb oder ein Filter entleeren, um Steine aufzufangen und dann zu analysieren, weil man dadurch wichtige Hinweise zur Steinvorbeugung erhält.
Medizinische Eingriffe bei blockierten Harnleitern
Ob ein Stein diesen Weg aus der Niere bis in die Blase von allein gehen kann, hängt von seiner Größe und Form ab. Steine bis zu einer Größe von 5 Millimetern können dies oft. Größere Steine bleiben meist im Harnleiter hängen und blockieren ihn, was zu einer dauerhaften Rückstauung in die Nieren führt. In diesem Fall muss zunächst diese Stauung beseitigt werden. Dies geschieht mithilfe eines dünnen Harnleiterkatheters (Stent), der bei einer Endoskopie von der Blase aus am Stein vorbei bis in das Nierenbecken eingeführt wird, so dann der gestaute Urin darüber abfließen kann. Manchmal kann bei einem solchen kleinen Eingriff auch der Stein selbst entfernt werden.
Nierenkoliken gehören zu den stärksten Schmerzen. Wenn das Problem bei Ihnen bekannt ist, sollten Sie immer Schmerzmittel in der Haus- oder Reiseapotheke vorrätig haben. Nehmen Sie im Fall einer beginnenden Kolik ein solches Schmerzmittel ein, sei es geschluckt oder als Zäpfchen. Es kann aber sein, dass die Krämpfe damit nicht ausreichend gelindert werden können. Dann muss ein Schmerzmittel über eine Vene als Injektion oder Infusion gegeben werden.
Welche medizinische Nachsorge ist möglich?
Eine sorgfältige medizinische Nachsorge ist für Patienten mit einer Vorgeschichte von Nierensteinen unerlässlich. Regelmäßige Besuche beim Urologen sind wichtig, um den Gesundheitszustand zu überwachen und gegebenenfalls Anpassungen der Behandlung vorzunehmen. Der Urologe wird abgegangene Steine analysieren lassen und kann Urin- und Bluttests durchführen, um die Konzentration von steinbildenden Substanzen zu überwachen und frühzeitig einzugreifen, falls sich das Risiko für eine erneute Steinbildung erhöht. Bildgebende Verfahren wie Ultraschall, Röntgenaufnahmen oder Computertomografien sind erforderlich, um das Vorhandensein von Steinen zu überprüfen und deren Größe und Lage zu bestimmen.
In bestimmten Fällen kann der Urologe Medikamente verschreiben, die helfen, die Bildung von Nierensteinen zu verhindern. Diese Medikamente können die Ausscheidung von steinbildenden Substanzen reduzieren oder die Zusammensetzung des Urins so verändern, dass die Bildung von Steinen erschwert wird. Beispiele für solche Medikamente sind spezielle Entwässerungsmittel, die die Kalziumausscheidung reduzieren, und Allopurinol, das die Harnsäureproduktion verringert. In manchen Fällen können bei Harnsäuresteinen durch Medikamente, die den Säurewert des Urins anheben, die Steine zum mindesten teilweise aufgelöst werden.
Was muss ich bei den häufigsten Steinarten (Kalziumoxalatsteine und Harnsäuresteine) beachten?
Für die häufigsten Steinarten, die Kalziumoxalatsteine und die Harnsäuresteine, finden Sie jetzt spezielle Hinweise, mit denen Sie das Wiederkommen der Steine behindern können.
Kalziumoxalatsteine sind die häufigsten Nierensteine und entstehen durch einen hohen Gehalt an Kalzium und Oxalat im Urin. Um das Risiko dieser Steine zu senken, sollten Patienten oxalatreiche Lebensmittel wie Spinat, Rhabarber, Nüsse und Schokolade meiden oder nur in geringen Mengen verzehren. Eine ausgewogene Kalziumzufuhr ist ebenfalls wichtig. Früher wurde angenommen, dass eine kalziumarme Ernährung vor Nierensteinen schützt. Heute weiß man jedoch, dass eine normale Kalziumzufuhr von etwa 1000 bis 1200 Milligramm pro Tag vorteilhaft ist, da Kalzium im Darm Oxalat bindet und dessen Aufnahme in den Urin verhindert. Die ausreichende Flüssigkeitszufuhr spielt auch bei Kalziumoxalatsteinen eine entscheidende Rolle. Zusätzlich kann die Einnahme von Citraten, die in Zitronensaft oder speziellen Nahrungsergänzungsmitteln enthalten sind, hilfreich sein. Citrat bindet Kalzium und verhindert die Bildung unlöslicher Kristalle.
Harnsäuresteine entstehen durch einen hohen Harnsäurespiegel im Urin, der oft auf eine purinreiche Ernährung zurückzuführen ist. Purine sind Substanzen, die in vielen Lebensmitteln enthalten sind und im Körper zu Harnsäure abgebaut werden. Besonders reich an Purinen sind Fleisch, Innereien wie Leber und Niere sowie bestimmte Fischsorten wie Sardellen und Makrelen. Um die Bildung von Harnsäuresteinen zu verhindern, sollten Patienten ihren Fleischkonsum reduzieren und vermehrt pflanzliche Lebensmittel zu sich nehmen. Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist ebenfalls wichtig, da sie den Urin verdünnt und die Kristallbildung verhindert. Es wird empfohlen, mindestens zwei bis drei Liter Wasser pro Tag zu trinken. Darüber hinaus kann der Verzehr von basenbildenden Lebensmitteln wie Obst und Gemüse den Urin weniger sauer machen, was die Bildung von Harnsäuresteinen erschwert.
Nebenwirkungen der Therapie
Nebenwirkungen der Therapie können je nach Maßnahme variieren. Medikamente können Nebenwirkungen wie Magen-Darm-Beschwerden, Schwindel oder Hautausschläge verursachen. Eine Änderung der Ernährungsgewohnheiten kann anfangs schwierig sein und erfordert oft eine Anpassungsphase. Eine erhöhte Flüssigkeitszufuhr kann bei manchen Patienten zu vermehrtem Harndrang oder, bei unzureichender Ausscheidung, zu Wasseransammlungen im Körper führen.
Was tun bei anderen Steinarten?
Sollte bei Ihnen eine andere Steinsorte vorliegen, fragen Sie bitte Ihre Urologin oder Ihren Urologen, was Sie in diesem Fall zur Vorbeugung tun können.
Zusammenfassung
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine Kombination aus ausreichender Flüssigkeitszufuhr, einer angepassten Ernährung, einem gesunden Lebensstil und regelmäßiger medizinischer Nachsorge entscheidend ist, um das Risiko für wiederholte Nierensteinbildungen zu verringern. Patienten sollten eng mit ihrem Urologen oder ihrer Urologin zusammenarbeiten, um eine individuelle Strategie zur Vorbeugung von Nierensteinen zu entwickeln und ihre Lebensqualität zu verbessern. Indem sie diese Maßnahmen befolgen, können sie die Bildung neuer Steine erschweren und die Belastung durch wiederholte Nierensteine erheblich reduzieren.
Weitere Informationen zum Thema:
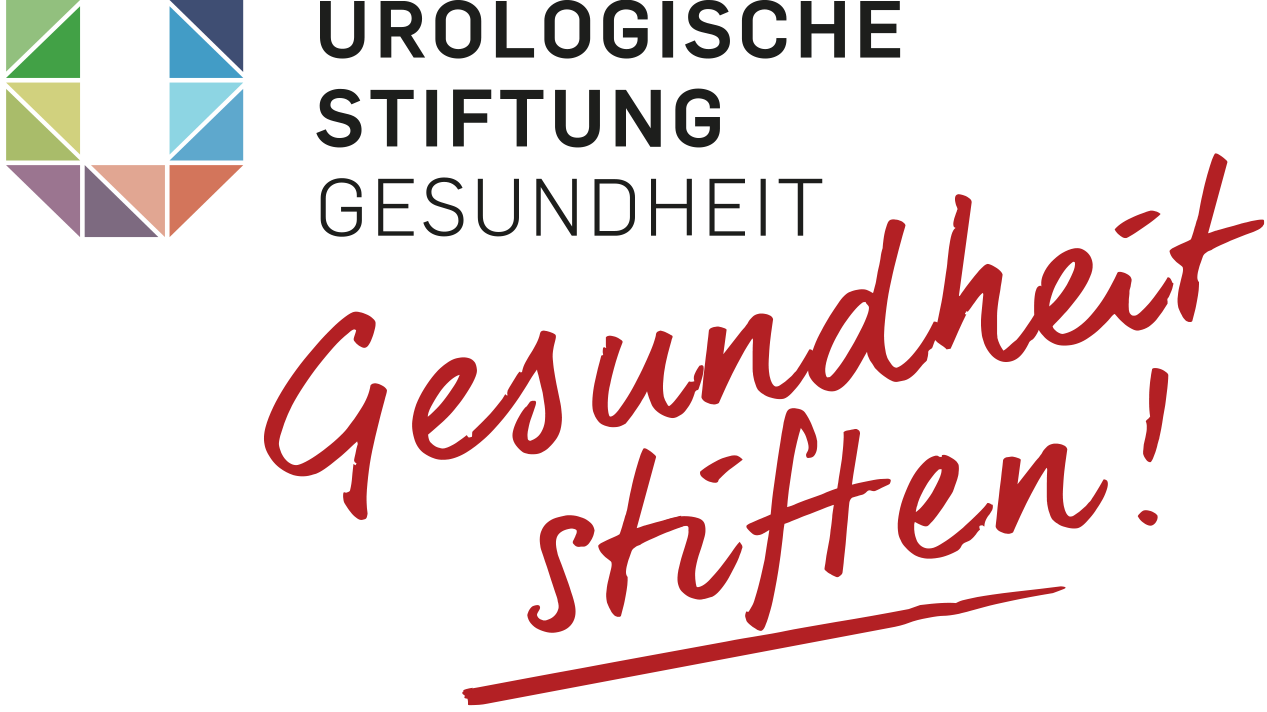
Liebe Patientin, lieber Patient,
wir hoffen, dass dieses Informationsmaterial der Urologischen Stiftung Gesundheit gGmbH für Sie von Nutzen war. In diesem Fall würden wir uns sehr freuen, wenn Sie unsere gemeinnützige Arbeit mit einer Spende unterstützen. Jeder noch so kleine Betrag hilft uns dabei, Menschen über urologische Erkrankungen zu informieren. Wir weisen abschließend darauf hin, dass Ihre Spende steuerlich absetzbar ist.
Für Ihre Gesundheit wünschen wir Ihnen alles Gute!
Dr. med. Holger Borchers
Prof. Dr. med. Helmut Haas
Geschäftsführer der Urologischen Stiftung Gesundheit gGmbH
Unser Spendenkonto:
Urologische Stiftung Gesundheit gGmbH
IBAN: DE85 2007 0000 0092 4258 00
BIC: DEUTDEHHXXX