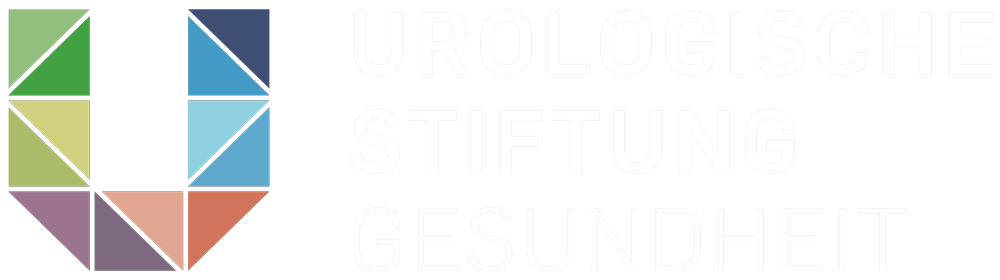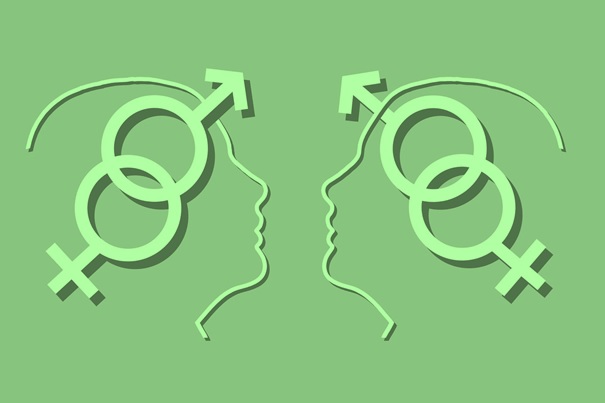Die Zahl der geschlechtsangleichenden Operationen hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen: So zeigte eine aktuelle Studie, die jüngst auf dem 76. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Urologie vorgestellt wurde, dass die Operationen von Frau zu Mann von 246 Fällen im Jahr 2006 auf 1.639 Fälle im Jahr 2021 stiegen; die Zahl der Operationen von Mann zu Frau stieg von 180 Fällen im Jahr 2006 auf 784 Fälle im Jahr 2021. Für das Jahr 2022 meldete die Datenbank Statista insgesamt 2600 geschlechtsangleichende Operationen in deutschen Krankenhäusern. Angesichts dieser Entwicklung wächst auch die Bedeutung der urologischen Betreuung von Transgender-Personen.
Die Transgender-Gesundheit in der Urologie bezieht sich auf die besonderen gesundheitlichen Bedürfnisse von Menschen, deren Geschlechtsidentität nicht mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht übereinstimmt. Urologische Betreuung spielt insbesondere bei der medizinischen Transition, geschlechtsangleichenden Operationen und Hormontherapien eine zentrale Rolle. Diese Eingriffe haben oft signifikante Auswirkungen auf den Urogenitaltrakt und eine spezialisierte Nachsorge ist essenziell, um langfristige Komplikationen zu vermeiden.
Geschlechtsangleichende Operationen und ihre Auswirkungen
Ein wichtiger Bestandteil der Transition vieler Transgender-Personen sind geschlechtsangleichende Operationen, die den Körper an die gewünschte Geschlechtsidentität anpassen sollen. Bei Transgender-Frauen führt die vaginoplastische Operation zu einer Verkürzung der Harnröhre, was das Risiko für Harnwegsinfektionen (HWI) erhöhen kann. Ebenso können Harnröhrenverengungen und Blasenfunktionsstörungen auftreten, was urologische Behandlungen erforderlich macht.
Transgender-Männer, die sich einer Phalloplastik oder Metoidioplastik unterziehen, haben oft mit Harnröhrenfisteln, Harnröhrenerweiterungen oder Strikturen zu kämpfen. Diese Komplikationen können zu Schwierigkeiten beim Wasserlassen führen, und zusätzliche chirurgische Korrekturen sind häufig notwendig. Eine regelmäßige postoperative Betreuung ist entscheidend, um die Blasenfunktion zu überwachen und langfristige Komplikationen zu verhindern.
Hormontherapie und urologische Auswirkungen
Die Hormontherapie spielt eine grundlegende Rolle in der Transition und kann tiefgreifende Auswirkungen auf die urologische Gesundheit haben. Bei Transgender-Frauen führt die Östrogen-Therapie zu einer Schrumpfung der Prostata, was das Risiko für Prostatakrebs verringern kann, jedoch bleibt die Prostata bestehen und sollte regelmäßig kontrolliert werden. Mögliche metabolische Auswirkungen der Hormontherapie im Langzeitverlauf sollten berücksichtigt werden.
Für Transgender-Männer bewirkt die Testosteron-Therapie eine Atrophie des vaginalen Gewebes, was das Risiko für Harnwegsinfektionen erhöht. Zudem berichten einige von Blasenproblemen, die regelmäßig überwacht werden sollten, um ernsthafte Komplikationen zu verhindern.
Urologische Erkrankungen bei Transgender-Personen
Transgender-Personen sind, wie alle anderen, anfällig für urologische Erkrankungen wie beispielsweise Harnwegsinfekte, Nierensteine oder Blasenkrebs. Nach geschlechtsangleichenden Operationen besteht ein erhöhtes Risiko für HWI, und regelmäßige Untersuchungen sind erforderlich, um ernsthafte Komplikationen zu verhindern. Transgender-Frauen sollten zudem, trotz der Schrumpfung der Prostata, regelmäßige Prostatakrebs-Untersuchungen durchführen lassen.
Vorsorge und Nachsorge
Regelmäßige urologische Vorsorgeuntersuchungen sind für Transgender-Personen von großer Bedeutung. Transgender-Frauen sollten auf die Gesundheit ihrer Prostata achten, während Transgender-Männer engmaschig auf postoperative Komplikationen wie Harnröhrenstrikturen oder Blasenfunktionsstörungen überwacht werden sollten. Präventive Maßnahmen wie ausreichend Flüssigkeitszufuhr, ein gesunder Lebensstil und der Verzicht auf Rauchen tragen dazu bei, das Risiko urologischer Erkrankungen zu senken.
Quelle: Geschlechtsangleichende Operationen in Deutschland: Trends von 2006 bis 2021
C. Aksoy, S. Wellenbrock, P. Reimold, P. Karschuck, M. Öztürk, T. Hirsch M. Sohn, N. Eisenmenger, S. Kliesch, S. Morgenstern, A. Zacharis, J. Huber, L. Flegar