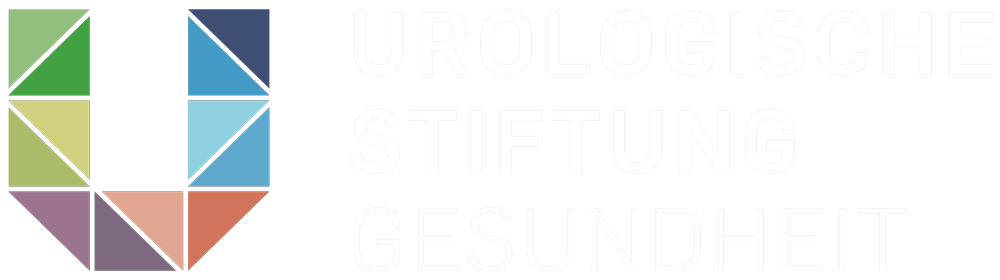Weiterführende Informationen
Häufigkeit und Risikofaktoren
Hodenkrebs ist eine bösartige Tumorerkrankung des Hodens und betrifft ausschließlich Männer. Bei Männern im Alter zwischen 20 und 40 Jahren stellt er den häufigsten bösartigen Tumor dar. Weltweit wird ein Anstieg der Neuerkrankungen beobachtet, was sich auch in Deutschland widerspiegelt. Die genauen Ursachen für diese Entwicklung sind bislang ungeklärt.
Ein erhöhtes Risiko für Hodenkrebs haben Männer, die in ihrer Kindheit an einem Hodenhochstand (auch Leistenhoden genannt) litten. Selbst nach einer späteren operativen Korrektur bleibt das Risiko für diese Patientengruppe signifikant erhöht. Zu den gesicherten Risikofaktoren zählen zudem genetische Veranlagungen, wie eine Hodentumorerkrankung bei einem Bruder, ein Tumor oder das Vorhandensein von Krebsvorläuferzellen im anderen Hoden (sogenannte TIN). Auch Fruchtbarkeitsstörungen erhöhen das Risiko. Bei Männern, die aufgrund eines unerfüllten Kinderwunsches einen Urologen konsultieren, tritt Hodenkrebs in etwa einem von 200 Fällen auf.
Urologen empfehlen eine regelmäßige Selbstuntersuchung beider Hoden durch Abtasten. Liegen bekannte Risikofaktoren vor, sollte zusätzlich eine jährliche Kontrolle durch einen niedergelassenen Urologen erfolgen, welche idealerweise eine Ultraschalluntersuchung der Hoden umfasst. So kann Hodenkrebs frühzeitig erkannt werden. Ein flächendeckendes Früherkennungsprogramm, wie etwa das Mammographie-Screening für Brustkrebs, existiert in Deutschland jedoch nicht.
Symptome
Die Erkrankung wird häufig durch eine schmerzlose Verhärtung oder Schwellung des betroffenen Hodens bemerkt. Schmerzen im Hoden können auftreten, sind jedoch kein eindeutiges Anzeichen für eine bösartige Erkrankung. Viele Betroffene schieben Veränderungen auf vermeintlich harmlose Ursachen, wie eine leichte Verletzung („beim Fußball abbekommen“), und zögern dadurch den Gang zum Arzt hinaus. Dies kann wertvolle Zeit kosten, die für eine frühzeitige Diagnose und Therapie entscheidend ist.
Ein veränderter Tastbefund, insbesondere eine schmerzlose Verhärtung, sollte immer ernst genommen werden und Anlass für einen Arztbesuch sein. Der Urologe kann durch eine körperliche Untersuchung und Ultraschalldiagnostik die Art der Veränderung abklären. Häufig ist es möglich, einen bösartigen Tumor von gutartigen Veränderungen, beispielsweise am Nebenhoden, zu unterscheiden.
Manchmal werden Hodenkrebserkrankungen auch im Rahmen von Routineuntersuchungen, etwa bei Fruchtbarkeitsstörungen, entdeckt. Solche Tumoren sind oft nicht tastbar. Zudem können unspezifische Symptome wie Lymphknotenschwellungen im Bauchraum oder Lungenmetastasen auf eine fortgeschrittene Erkrankung hinweisen. Bei jungen Männern sollte bei solchen Befunden stets auch eine Untersuchung der Hoden erfolgen, um einen möglichen Hodentumor als Ursache nicht zu übersehen.
Diagnose und Hodentumormarker
Wenn der Urologe aufgrund einer Untersuchung den Verdacht auf Hodenkrebs äußert, wird eine operative Abklärung empfohlen. Vor dem Eingriff wird dem Patienten Blut abgenommen, um die sogenannten Hodentumormarker zu bestimmen. Diese Marker sind Proteine und Enzyme, die bei einer Hodenkrebserkrankung vermehrt im Blut auftreten können. Dazu zählen:
- AFP (Alpha-Feto-Protein)
- HCG (Humanes Choriongonadotropin)
- LDH (Lactatdehydrogenase)
Die Tumormarker sind nicht spezifisch, was bedeutet, dass erhöhte Werte nicht zwangsläufig auf Hodenkrebs hindeuten. So können beispielsweise leicht erhöhte AFP-Werte bei Rauchern auftreten, und erhöhte LDH-Werte sind häufig eine Folge körperlicher Belastung. Ebenso schließen unauffällige Tumormarker eine Hodenkrebserkrankung nicht aus. Dennoch liefern sie wichtige Hinweise zur Art des Tumors und zur Planung der Therapie. Auch in der Verlaufskontrolle und Nachsorge spielen diese Werte eine zentrale Rolle.
Operative Behandlung
Die Operation ist der nächste diagnostische und therapeutische Schritt. Dabei wird unter Narkose ein Schnitt in der Leiste vorgenommen, um den Hoden samt Samenstrang freizulegen. Falls der Tumor eindeutig bösartig ist, wird der betroffene Hoden samt Samenstrang entfernt. Ist die Diagnose unklar, erfolgt während der Operation eine Schnellschnittuntersuchung durch einen Pathologen, der noch während des Eingriffs eine erste Einschätzung abgibt. Sollte der Befund sicher bösartig sein, so wird der betroffenen Hoden mit dem Samenstrang der betroffenen Seite entfernt.
Zusätzlich wird in derselben Operation Gewebe aus dem gesunden Hoden der Gegenseite entnommen, um mögliche Krebsvorläuferzellen zu erkennen. Diese Information ist für die weitere Therapieplanung essenziell.
Auf Wunsch kann während des Eingriffs eine Hodenprothese eingesetzt werden. Es handelt sich hierbei um ein Silikonkissen, das in der Größe dem gesunden Hoden angepasst wird. Sie dient ausschließlich kosmetischen Zwecken, da sie keine hormonellen oder reproduktiven Funktionen übernehmen kann.
Der Eingriff dauert in der Regel 60 bis 90 Minuten, und der Krankenhausaufenthalt umfasst meist zwei bis drei Tage. Die Operation ist somit für die Diagnosestellung erforderlich, aber auch gleichzeitig der erste wichtige therapeutische Schritt, da hierdurch der eigentliche Tumor aus dem Körper entfernt wird. In besonderen Fällen, wie bei fortgeschrittener Erkrankung mit zahlreichen Metastasen, kann eine abweichende Therapie notwendig sein. Beispielsweise könnte eine Chemotherapie vor der Operation erfolgen. Bei sehr kleinen Tumoren im Einzelhoden kann unter Umständen ein Teil des Hodengewebes erhalten bleiben. Solche Entscheidungen werden individuell in Absprache mit einem erfahrenen Urologen getroffen.
Folgen der Operation und Hodenfunktionen
Der gesunde Hoden erfüllt zwei essenzielle Funktionen: die Produktion des männlichen Hormons Testosteron und die Bildung von Spermien. Ein gesunder Hoden allein ist normalerweise in der Regel ausreichend, um beide Funktionen vollständig aufrechtzuerhalten. Dennoch sollte im Rahmen der Nachsorge regelmäßig der Testosteronspiegel überprüft werden, um einen möglichen Testosteronmangel frühzeitig zu erkennen. Falls die Therapie eine Entfernung beider Hoden erforderlich macht oder der verbliebene Hoden nicht mehr ausreichend Testosteron produziert, kann das Hormon problemlos medikamentös ergänzt werden. Dafür stehen Testosteron-Gele oder Depotspritzen zur Verfügung.
Möglichkeiten der Kryokonservierung
Da Hodenkrebs vor allem junge Männer betrifft, die häufig noch eine Familienplanung anstreben, ist die Kryokonservierung von Spermien eine wichtige Option. Bei der Kryokonservierung werden Spermien des Patienten durch Masturbation gewonnen und eingefroren. Diese können unbegrenzt im Gefrierdepot gelagert werden und stehen für eine spätere Kinderwunschbehandlung zur Verfügung, falls sich die Ejakulatqualität durch die Therapie dauerhaft verschlechtert.
Die Kosten für die Kryokonservierung werden von der gesetzlichen Krankenversicherung übernommen. Am 16. Juli 2020 entschied der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA), dass die Kryokonservierung von Ei- und Samenzellen sowie die dazugehörigen medizinischen Maßnahmen ab dem 1. Juli 2021 unter bestimmten Voraussetzungen von der GKV übernommen werden. Patienten können somit vor einer potenziell keimzellschädigenden Therapie die Kryokonservierung und die notwendigen medizinischen Maßnahmen in Anspruch nehmen. Weitere Informationen zur Inanspruchnahme dieser Leistungen finden Sie auf der Webseite des G-BA.
Die Kryokonservierung sollte vor der operativen Entfernung des tumortragenden Hodens oder spätestens vor einer möglichen Strahlen- oder Chemotherapie durchgeführt werden. Etwa zwölf Monate nach Abschluss der Therapie wird eine Kontrolle der Ejakulatqualität empfohlen, um über die weitere Notwendigkeit der Kryokonservierung zu entscheiden.
Die Wahrscheinlichkeit einer dauerhaften Einschränkung der Fruchtbarkeit hängt wesentlich von der Art und dem Umfang der Hodentumortherapie ab. Eine pauschale Aussage zu den Fruchtbarkeitschancen ist daher nicht möglich.
Klassifikation und Therapie
Neben der operativen Entfernung des Tumors ist vor der Therapie eine umfassende bildgebende Diagnostik erforderlich. Dazu zählt die Computertomographie (CT) von Brustkorb und Bauchraum, um die sogenannte Ausbreitungsdiagnostik (Staging) abzuschließen. Mit der CT können Metastasen erkannt werden, die häufig entlang der Hauptschlagader (Aorta) oder in der Lunge auftreten. Seltener finden sich Metastasen in Leber, Gehirn oder Knochen.Nach Abschluss der CT-Untersuchung wird in der Regel das Ergebnis der feingeweblichen Untersuchung (Histologie) des Tumors abgewartet.
Hodentumoren werden grundsätzlich in Seminome und Nicht-Seminome unterteilt, da sich diese Tumorarten in ihrem Verhalten und in der Behandlung unterscheiden. Gutartige Hodentumoren sind zwar möglich, jedoch sehr selten. Die genaue Klassifizierung des Tumors erfolgt durch den Pathologen anhand der Gewebeprobe, ergänzt durch die Werte der Hodentumormarker und die Ergebnisse der bildgebenden Verfahren. Die Klassifikation bildet die Grundlage für die Auswahl der geeigneten Therapieoptionen.
Da jede Hodenkrebserkrankung individuell verläuft, sind die Behandlungsoptionen vielfältig. In vielen Fällen gibt es für dasselbe Erkrankungsstadium unterschiedliche Therapieansätze. Eine umfassende Beratung durch den behandelnden Urologen, der Vor- und Nachteile der Verfahren erläutert, ist daher unerlässlich. Falls gewünscht, kann auch eine Zweitmeinung eingeholt werden, beispielsweise über spezialisierte Zentren wie www.zm-hodentumor.de.
Therapie des Seminom
Bei einem auf den Hoden begrenzten Seminom ohne Metastasen gibt es die Möglichkeit einer engmaschigen Nachsorge (Active Surveillance) oder einer vorbeugenden Chemotherapie mit einem Zyklus Carboplatin-Mono (AUC-7). Die Strahlentherapie spielt aufgrund potenzieller Spätfolgen in frühen Stadien nur noch eine untergeordnete Rolle.
Die Entscheidung für eine Therapie richtet sich nach dem Pathologiebefund und der individuellen Rückfallwahrscheinlichkeit. Persönliche Faktoren wie die Bereitschaft zur engmaschigen Nachsorge und die Präferenzen des Patienten spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Der Nutzen einer vorbeugenden Therapie, die das Rückfallrisiko senkt, muss stets gegen die Nebenwirkungen und Risiken der Therapie abgewogen werden.
Bei Seminompatienten mit Metastasen kommt je nach Lokalisation der Tochtergeschwülste eine Chemotherapie oder Strahlentherapie infrage. Sollten nach Abschluss dieser Therapien Resttumoren, beispielsweise in den Lymphknoten entlang der Aorta, bestehen bleiben, kann eine operative Entfernung notwendig sein. Auch in fortgeschrittenen Stadien sind die Heilungschancen bei fachgerechter Behandlung hoch.
Therapie des Nicht-Seminom
Bei Nicht-Seminomen, die sich auf den Hoden beschränken, bestehen ebenfalls Optionen wie eine engmaschige Nachsorge (Active Surveillance) oder eine vorbeugende Chemotherapie mit ein bis zwei Zyklen PEB (Cisplatin, Etoposid und Bleomycin). Eine Strahlentherapie wird bei Nicht-Seminomen nicht eingesetzt.
Die Empfehlung richtet sich auch hier nach dem individuellen Risikoprofil des Patienten, dem histologischen Befund und der Bereitschaft zur Mitarbeit des Patienten. Bei Metastasenbildung ist in der Regel eine Chemotherapie erforderlich, deren Umfang von der Lokalisation der Metastasen und der Tumormarkerhöhe abhängt. Üblicherweise sind drei bis vier Zyklen der PEB-Chemotherapie notwendig. Resttumoren nach Abschluss der Chemotherapie werden in den meisten Fällen chirurgisch entfernt. Selbst in fortgeschrittenen Stadien mit Metastasenbildung sind die Heilungschancen dank moderner Therapien sehr gut.
Falls eine Standard-Chemotherapie nicht den gewünschten Erfolg bringt, bei Hochrisikosituationen oder wenn nach komplexer Vortherapie ein Rezidiv der Hodenkrebserkrankung auftritt, wird der Patient in einem spezialisierten Zentrum für Hodentumore weiterbehandelt.
Hodentumornachsorge
Die Nachsorge spielt bei allen Hodenkrebspatienten eine zentrale Rolle. In den ersten zwei Jahren nach der Therapie sind die Nachsorgeintervalle engmaschig, da das Risiko eines Rückfalls in diesem Zeitraum am höchsten ist. Alle drei Monate erfolgen Ultraschalluntersuchungen des verbliebenen Hodens, körperliche Untersuchungen und Blutentnahmen zur Bestimmung der Hodentumormarker sowie des Hormonprofils.
Da eine CT-Untersuchung zwar die genauste Methode ist, Metastasen durch einen Hodentumor im Körper aufzuspüren, ist diese in der Hodentumornachsorge notwendig. Allerdings stellt diese Untersuchung für den Patienten auch eine deutliche Strahlenbelastung dar, so dass die Häufigkeit der notwendigen Untersuchungen auf ein Mindestmaß reduziert werden muss. Durch die Strahlenbelastung könnte ansonsten das Risiko sog. Zweitmalignome (Strahleninduzierte Tumore) zu entwickeln stark ansteigen. Üblicherweise wird mit dem Patienten ein Nachsorgeschema vereinbart, was von Arzt und Patient unbedingt eingehalten werden sollte. Nach fünf Jahren kann die Nachsorge bei unauffälligem Verlauf auf jährliche Untersuchungen reduziert werden.
Häufige Fragen zu Hodenkrebs
Wie erkenne ich Hodenkrebs frühzeitig?
Hodenkrebs zeigt sich oft durch eine schmerzlose Verhärtung oder Schwellung des Hodens. Eine regelmäßige Selbstuntersuchung ist der wichtigste Schritt zur frühzeitigen Erkennung.
Ist Hodenkrebs vererbbar?
Eine genetische Veranlagung kann das Risiko erhöhen, besonders wenn ein Bruder bereits an Hodenkrebs erkrankt ist. Auch andere familiäre Fälle können die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung beeinflussen.
Kann Hodenkrebs geheilt werden?
Ja, Hodenkrebs hat eine hohe Heilungsrate, insbesondere wenn er früh erkannt wird. Moderne Therapien ermöglichen oft eine vollständige Genesung.
Wann ist eine Kryokonservierung sinnvoll?
Die Kryokonservierung sollte vor einer Therapie erfolgen, die die Keimzellen schädigen könnte. Dazu zählen Operationen, Strahlen- oder Chemotherapien.
Übernimmt die Krankenkasse die Kosten der Kryokonservierung?
Ja, die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen seit dem 1. Juli 2021 die Kosten unter bestimmten Voraussetzungen. Diese Leistung gilt für alle Patienten vor keimzellschädigenden Therapien.
Wie lange können Spermien eingefroren werden?
Eingefrorene Spermien können zeitlich unbegrenzt im Depot gelagert werden. Sie stehen später für Kinderwunschbehandlungen zur Verfügung.