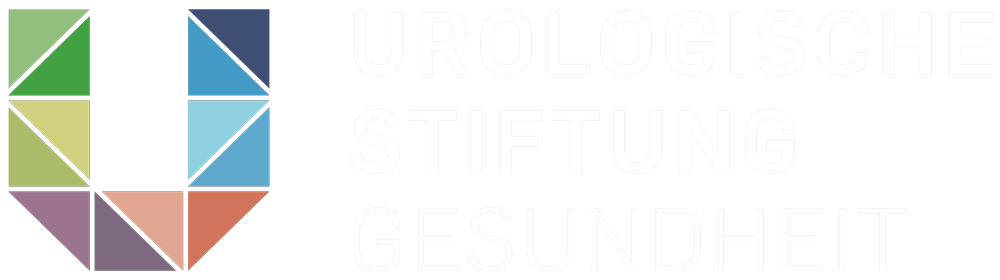Eine zentrale Rolle spielt dabei die Pathologie. Sie liefert die entscheidenden Grundlagen für die Therapieplanung und bestimmt maßgeblich den weiteren Verlauf der Behandlung.
Die Urologische Stiftung Gesundheit hat hierzu mit Prof. Dr. Sven Perner, einem der führenden Pathologen auf diesem Gebiet, gesprochen.
Was ist der Gleason Score und warum ist er so wichtig?
Wenn Gewebeproben (Biopsien) aus der Prostata entnommen werden, untersucht der Pathologe diese unter dem Mikroskop, um festzustellen, ob Prostatakrebs vorliegt oder nicht.
Wenn Prostatakrebs diagnostiziert wird, muss der Pathologe noch festlegen, wie aggressiv der Krebs ist.
Hierzu wurde der Gleason Score entwickelt. Dieses Bewertungssystem dient der Beurteilung der Aggressivität von Prostatakrebs.
Dabei schaut sich der Pathologe an, wie stark sich die Krebsverbände vom gesunden Prostatagewebe unterscheiden.
Je mehr die Krebsverbände dem normalen Prostatagewebe gleichen, desto weniger aggressiv ist der Krebs.
Je weniger sie dem gesunden Gewebe ähneln, desto aggressiver verhält sich der Tumor.
Es werden die beiden häufigsten Wachstumsmuster betrachtet und jeweils mit 1 bis 5 Punkten bewertet.
1 = Krebswachstum sehr ähnlich zum normalen Gewebe, wenig aggressiv
5 = Krebswachstum stark verändert, sehr aggressiv
Beide Werte werden addiert und ergeben den Gleason Score, zum Beispiel 3 + 4 = 7.
Niedriger Score (≤ 6): Tumor wächst eher langsam
Mittlerer Score (7): Tumor mit mittlerer Aggressivität
Hoher Score (8–10): Sehr aggressiver Tumor, wächst schnell und streut früh
Der vom Pathologen erhobene Gleason Score ist damit einer der entscheidenden Faktoren für die Behandlungsplanung.
Er hilft einzuschätzen, ob eine aktive Überwachung ausreicht oder ob eine operative oder medikamentöse Therapie notwendig ist.
Welche Rolle spielt die Pathologie bei der Therapieplanung?
Die Pathologie spielt eine zentrale Rolle in der modernen Medizin und ist weit mehr als ein Hintergrundakteur.
Pathologen liefern die entscheidenden Informationen, auf deren Basis Therapien überhaupt gezielt geplant werden können.
Erst durch die Analyse von Gewebeproben, Zellen und molekularen Markern kann festgestellt werden, welche Erkrankung genau vorliegt.
Es kann sich um keinen Tumor, einen gutartigen Tumor oder einen bösartigen Tumor handeln.
Falls es sich um einen bösartigen Tumor handelt, bestimmt die Pathologie zudem den Untertyp.
Ebenso wird durch die Untersuchung festgelegt, wie aggressiv ein Tumor ist und welche molekularen Eigenschaften er aufweist.
Prof. Perner betont: „Pathologen sind der Lotse der Therapie, sie navigieren Ärzteteams durch die Vielzahl möglicher Behandlungswege und sorgen dafür, dass Patientinnen und Patienten die bestmögliche Behandlung erhalten.“
Woran erkennt man, ob ein Tumor gutartig oder bösartig ist?
Ob ein Tumor gutartig oder bösartig ist, zeigt sich am klinischen Verhalten.
Ein gutartiger Tumor wächst meist langsam, ist klar begrenzt und verdrängt Nachbargewebe.
Ein bösartiger Tumor wächst schneller, dringt in umliegende Strukturen ein und kann auch in andere Organe streuen.
Unter dem Mikroskop achten Pathologen auf typische Merkmale:
- Zellform und Größe: Bösartige Tumorzellen wirken oft unregelmäßig und variabel, gutartige dagegen gleichmäßiger.
- Kernveränderungen: Bösartige Zellen haben häufig vergrößerte, dunkel gefärbte Kerne mit auffälligen Kernkörperchen.
- Teilungsrate: Viele Mitosen, teilweise in untypischer Form, sprechen für eine hohe Aggressivität.
Warum zeigen Gewebeproben nicht immer das ganze Bild?
Eine Gewebeprobe liefert oft entscheidende Hinweise, zeigt aber nur einen Ausschnitt des gesamten Tumors oder Gewebes.
Das kann die Aussagekraft einschränken.
- Probengröße: In einer Biopsie steckt nur ein winziger Teil des Tumors. Veränderungen in anderen Arealen bleiben unentdeckt.
- Repräsentativität: Tumoren können heterogen sein. Manche Bereiche wirken harmloser, andere deutlich aggressiver.
- Technische Grenzen: Manche Strukturen oder Marker lassen sich erst im vollständigen Operationspräparat sicher beurteilen.
- Zeitpunkt der Entnahme: Tumoren können sich im Verlauf verändern. Eine ältere Probe entspricht möglicherweise nicht mehr dem aktuellen Tumorverhalten.
Prof. Perner fasst es so zusammen: „Eine Biopsie ist wie ein Blick durchs Schlüsselloch. Man sieht einen wichtigen Ausschnitt, aber nicht unbedingt den ganzen Raum.“
Was lässt sich aus all dem für die Patienten ableiten?
Das Gespräch mit Prof. Dr. Sven Perner macht deutlich, wie essenziell die Pathologie für die moderne Krebsmedizin ist.
Sie klärt nicht nur die Diagnose, sondern bestimmt auch das therapeutische Vorgehen.
Besonders beim Prostatakarzinom ist der Gleason Score ein entscheidender Faktor, der die Richtung vorgibt.
Ohne die präzise Arbeit der Pathologen wäre eine individualisierte und erfolgreiche Therapie nicht möglich.