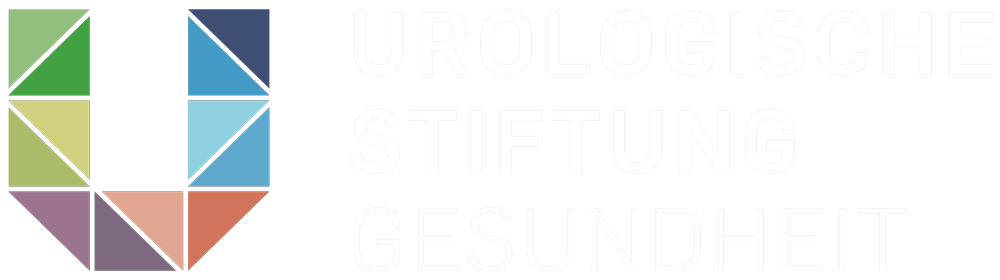A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
Z
Überlaufblase
Der Begriff beschreibt den Zustand einer ständig überfüllten Blase. Ursache hierfür ist die Unfähigkeit, die Blase zu entleerten. Gründe können beim Mann vor allem eine stark vergrößerte Prostata und bei der Frau in erster Linie eine Funktionsstörung des Blasenmuskels und dessen Nervenversorgung sein.
Folge ist, dass eine kontrollierte Blasenentleerung oft unmöglich ist und eine Inkontinenz eintritt. Man spricht dann von Überlaufinkontinenz. Der Zustand bedarf einer eingehenden Diagnostik und Therapieplanung, welche sich individuell nach den Ursachen richtet. Unbehandelt ist eine teilweise Entleerung der Harnblase oft nur mit starkem Einsatz der Bauchmuskulatur (pressen) möglich. Hierdurch können die Nieren und der obere Harntrakt Schaden nehmen. Zudem kann ein sog. Harnverhalt auftreten. Hier ist dann eine spontane Blasenentleerung gar nicht mehr möglich. Es muss ein Blasenkatheter gelegt werden.
Überlaufkontinenz
Harninkontinenz aufgrund einer Überlaufblase. Die Überlauf- Inkontinenz entsteht, wenn der Urin durch ein Hindernis in der Harnröhre nicht richtig abfließen kann und die Blase schließlich „überläuft“. Auch eine Schädigung des Nervensystems (durch Bandscheibenvorfall, Diabetes, Alkoholismus) kann zum Überläufen führen. Eine häufige Krankheit, die diese Form der Inkontinenz auslöst, ist die eine Prostata- Vergrößerung (Hypertrophie).
Ulcus molle (weicher Schanker)
Geschlechtskrankheit. In Mitteleuropa selten, aber in tropischen Ländern verbreitet. Erste Symptome treten 2 bis 6 Tage nach der Ansteckung auf. Am Ort der Ansteckung finden sich rötliche Geschwüre, oft mit zackigem Rand. Die Lymphknoten in der Nähe dieser Entzündung können geschwollen und schmerzhaft sein. Frauen sind oft Überträger, d.h. sie haben keine Beschwerden, sind aber ansteckend. Übertragung erfolgt fast ausschließlich durch Geschlechtsverkehr. Eine indirekte Übertragung (Schmierinfektion) ist möglich. Kondome und normale Körperhygiene schützen. Die Therapie erfolgt mit Antibiotika. Wichtig ist die Behandlung beider Partner.
Ultraschalluntersuchung
Medizinisches Verfahren, mit dem verschiedene Körperregionen und Organe untersucht werden können. Zur Bildgebung werden (Ultra-)Schallwellen mit Frequenzen ab 20 kHz genutzt, die oberhalb des Frequenzbereichs liegen, der vom Menschen wahrgenommen werden kann.
Ureter
Fachbegriff für den Harnleiter. Verbindet Nierenbecken mit der Harnblase und sorgt damit für den Urintransport.
Ureterocutaneostomie
Operative Verlagerung des Harnleiterendes in die Haut zur dauerhaften Urinableitung.
Urethra
Fachbegriff für die Harnröhre.
Urethritis
Harnröhrenentzündung
Urethrografie
Darstellung der Harnröhre mittels Röntgen nach Kontrastmittelgabe
Urgeinkontinenz
Andere Bezeichnung für eine Dranginkontinenz. Kennzeichnend sind ein plötzlich einsetzender, nicht mehr zu kontrollierender Harndrang und Urinverlust. Davon abzugrenzen ist die Belastungsinkontinenz, bei der ein Urinverlust in erster Linie bei körperlicher Belastung (Husten, Niesen, Heben, Hüpfen) auftritt und nicht von einem Harndrang begleitet wird. Eine genauere Erklärung liefert unser Patientenratgeber Harninkontinenz.
Urin
Der Urin (Harn) besteht hauptsächlich aus Wasser. Im Harn finden sich Stoffwechselprodukte des Köpers wie Harnstoff, Harnsäure, Salze und Säuren. Die gelbe Farbe des Harns kommt vom Gallenfarbstoff (Bilirubin), welcher ein Produkt der sich ständig erneuernden roten Blutkörperchen ist. Bei geringer Trinkmenge ist der Urin konzentrierter und damit stärker gefärbt. Bei hoher Trinkmenge eher klar und weniger stark gefärbt. Brauner oder rötlicher Urin weist auf eine Blutung im Bereich der Nieren oder der ableitenden Harnwege hin (Hämaturie). Bereits wenige rote Blutkörperchen erwecken den Eindruck einer starken Blutung, da Blut in diesem Fall ein starker Farbstoff ist. Der tatsächliche Blutverlust ist allerdings meist sehr gering. Befinden sich viele weiße Blutkörperchen im Urin, ist die Farbe weißlich oder cremig (Leukozyturie). Dies kann ein Zeichen für eine Entzündung im Bereich der ableitenden Harnwege sein.
Urinkultur
Dient zum Bakteriennachweis und Bakteriendifferenzierung im Urin. Auf einen Nährboden wird frisch gewonnener Harn aufgebracht und anschließend über 24 Stunden in einem Wärmeschrank bebrütet. So lässt sich feststellen, ob ein Wachstum von Keimen stattgefunden hat. Bei einem Keimwachstum erfolgt die Feststellung und Austestung des Erregers. Nach Vorliegen des Ergebnisses kann der Patient gezielt mit dem für ihn bestmöglichen Medikament behandelt werden.
Urinom
Urinansammlung außerhalb des Harntrakts, z.B. durch eine Verletzung des Nierenbeckens, des Harnleiters oder der Blase.
Uroflow
Urologie
(griechisch „ouron“ Harn und „logos“ die Lehre)
Dieses medizinische Teilgebiet umfasst die Untersuchung und Behandlung von Erkrankungen der Harnwege und der männlichen Geschlechtsorgane.
Urosepsis
Lebensbedrohliche Komplikation einer bakteriellen Infektion der Harnwege. Auf dem Boden einer Harnabflussstörung bei gleichzeitig bestehendem Harnwegsinfekt kommt es zu Fieber, Schüttelfrost, Krankheitsgefühl und Schmerzen. Die Urosepsis ist durch den Übertritt von Bakterien aus dem Urin in die Blutbahn bedrohlich und führt unbehandelt häufig zum Tode.
Urostoma
Operativ angelegte Urinableitung über die Bauchdecke.
URS = Ureterorenoskopie (Harnleiterspiegelung)
Rein diagnostisch zur Abklärung der oberen Harnwege (Harnleiter, Nierenbeckenkelchsystem der Niere) oder zur Therapie von Harnsteinen eingesetzt. Das Instrument wird in Narkose über die Harnröhre in den Harnleiter eingeführt. Es stehen flexible und starre Instrumente zur Verfügung. Im Harntrakt können die Harnsteine unter direkter Sicht an Ort und Stelle mit entsprechenden Geräten (z.B. Laser) zertrümmert und entfernt werden. Bei kleinen Steinen können diese oft auch ohne Zertrümmerung mit speziellen kleinen Zangen oder Fangkörbchen geborgen werden.