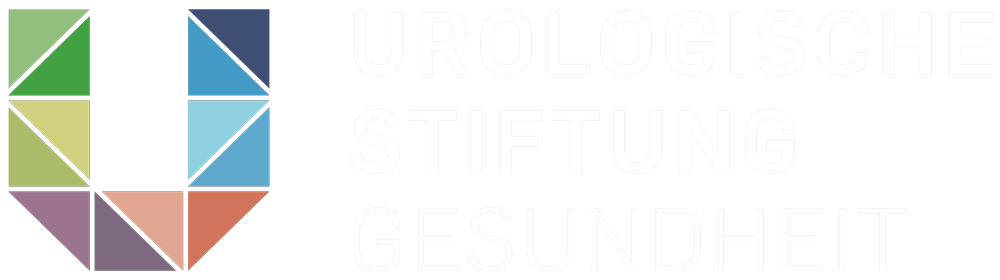Kurzüberblick
Die Interstitielle Zystitis ist eine chronische, nicht infektiöse Erkrankung der Harnblase mit anhaltenden Schmerzen im Beckenbereich, starkem Harndrang und häufigem Wasserlassen. Im klinischen Sprachgebrauch wird zwischen Interstitieller Zystitis und Blasenschmerzsyndrom unterschieden. Beide Entitäten überschneiden sich, sind jedoch nicht deckungsgleich. Die aktuelle S2k Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Urologie beschreibt Definition, Diagnostik und Therapie strukturiert und bildet die Grundlage für die Versorgung in Deutschland. Für Patientinnen und Patienten ist wichtig, dass eine urologische Abklärung erforderlich ist und andere Ursachen zuverlässig ausgeschlossen werden. Erst dann kann die Diagnose gestellt und eine passende Behandlung begonnen werden.
Was bei der Erkrankung passiert
Die Blasenschleimhaut schützt normalerweise vor im Urin enthaltenen Reizstoffen. Wird diese Schutzbarriere durchlässiger, treffen Reizstoffe leichter auf sensible Nervenendigungen. Das kann lokale Entzündungsreaktionen verstärken und Schmerzen unterhalten. In der Fachliteratur werden außerdem neurogene Mechanismen, eine Autoimmunreaktion und Überlappungen mit anderen Schmerzsyndromen beschrieben. Bei einem Teil der Betroffenen finden sich endoskopisch sichtbare, begrenzte Schleimhautveränderungen, die als Hunner Läsionen bezeichnet werden und auch als Hunner’sche Ulzera bekannt sind. Dieser Befund ist diagnostisch wegweisend und hat therapeutische Konsequenzen.
Symptome und Abgrenzung
Typisch sind Blasenschmerz oder Druckgefühl, starker Harndrang, Nykturie und eine deutliche Einschränkung der Lebensqualität. Die Beschwerden ähneln mitunter einer Reizblase oder einer Blasenentzündung. Entscheidend ist daher der Nachweis, dass kein akuter Harnwegsinfekt vorliegt und dass alternative Ursachen wie Steine, Tumoren oder gynäkologische Erkrankungen nicht zutreffen. Ein vorschneller Schluss auf Interstitielle Zystitis ist nicht zielführend. Die S2k Leitlinie empfiehlt eine geordnete Abklärung, um Fehldiagnosen zu vermeiden und Betroffenen den passenden Weg in die Behandlung zu ermöglichen.
Diagnostik in Schritten
Am Beginn stehen eine gründliche Anamnese, ein Symptom und Miktionsprotokoll, die körperliche Untersuchung sowie Urinstatus und Urinkultur. Je nach Befund folgen Sonografie, urologische Funktionsdiagnostik und bei Bedarf eine Zystoskopie. Damit lassen sich Hunner Läsionen sicher erkennen. Einen einzelnen Laborwert, der die Diagnose allein bestätigt, gibt es nicht. Die Diagnose ergibt sich aus der Gesamtschau der Befunde und dem strukturierten Ausschluss anderer Ursachen. Dieses Vorgehen verhindert unnötige Eingriffe und lenkt die Behandlung auf die wirksamen Bausteine.
Therapie nach Phänotyp und Bedarf
Ziel der Behandlung ist eine spürbare Linderung der Symptome und eine stabile Lebensqualität. Zuerst stehen Aufklärung, das Erkennen von individuellen Triggern, eine angepasste Trinkmenge und Ernährungsfaktoren sowie Beckenbodenphysiotherapie. Bei Bedarf kommen Medikamente infrage, zum Beispiel niedrig dosierte Antidepressiva oder Antihistaminika. In ausgewählten Situationen können intravesikale Therapien mit Hyaluronsäure oder Chondroitinsulfat sowie Dimethylsulfoxid eingesetzt werden. Beim Hunner Typ sind endoskopische Verfahren bis hin zur Koagulation oder Resektion möglich. Für schwer behandelbare Verläufe werden Botulinumtoxin und Neuromodulation als Optionen beschrieben. Die Auswahl folgt dem klinischen Bild, den Komorbiditäten und den Therapiezielen und wird regelmäßig überprüft.
Zertifizierte Zentren und neue Orphanet Übersicht
Spezialisierte IC und Beckenschmerzzentren bieten strukturierte Diagnostik und Therapie nach Leitlinie. Die Zertifizierung erfolgt gemeinsam durch die Deutsche Kontinenz Gesellschaft und die Deutsche Gesellschaft für Urologie. Zuständig für die Organisation des Verfahrens ist die Deutsche Kontinenz Gesellschaft. Das gemeinsame Zertifizierungsverfahren wurde in den letzten Jahren etabliert und wird fortlaufend umgesetzt.
Neu und für die Orientierung besonders hilfreich ist die gebündelte Orphanet Übersicht der Expert Centres für Interstitial cystitis. Seit 2025 sind dort deutsche, nach gemeinsamen Kriterien zertifizierte Einrichtungen auffindbar. Die Seite ermöglicht eine gezielte Suche und verlinkt auf die Profile einzelner Zentren. Direkt zur Übersicht:
Weiterführende Informationen
- AWMF Registereintrag:
043 050 IC/BPS - PDF Langversion 2.0 vom 10.07.2025:
Leitlinie IC/BPS - Leitlinienübersicht der DGU:
Urologenportal Leitlinien
- AWMF Registereintrag:
Literatur
Deutsche Gesellschaft für Urologie. (2024). S2k Leitlinie Diagnostik und Therapie der Interstitiellen Cystitis IC/BPS. AWMF Register 043 050. Version 2.0, Stand 30.09.2024. Verfügbar unter
https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/043-050
und als PDF vom 10.07.2025
Langversion.
Deutsche Kontinenz Gesellschaft. (o. J.). Zertifizierungsverfahren für Zentren der Interstitiellen Zystitis. Verfügbar unter
https://www.kontinenz-gesellschaft.de/die-gesellschaft/zertifizierung-anerkennung/.
Urologenportal der DGU. Leitlinienübersicht mit Verweis auf IC/BPS. Verfügbar unter
https://www.urologenportal.de/fachbesucher/wirueberuns/dgu/leitlinien-der-deutschen-gesellschaft-fuer-urologie.html.