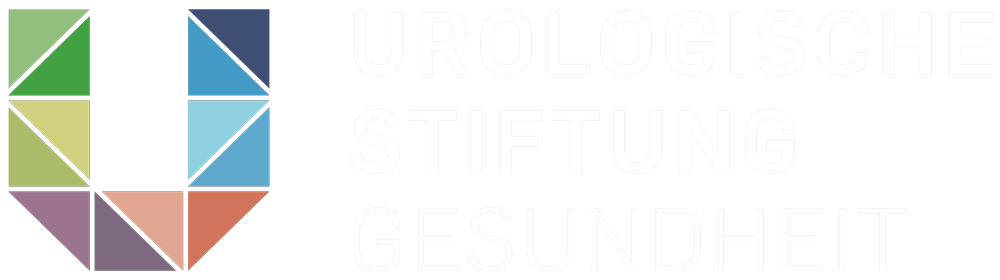Der unwillkürliche Urinverlust, medizinisch Harninkontinenz, ist eine Volkskrankheit: In Deutschland sind rund zehn Millionen Menschen von verschiedenen Formen der Inkontinenz betroffen. Frauen leiden, oft aufgrund von Schwangerschaft, Geburt oder Wechseljahren, häufiger an einer Blasenschwäche als Männer. Bei der Abklärung und Behandlungsplanung kommen unterschiedliche diagnostische Maßnahmen zum Einsatz. Eine schottische Studie untersuchte jüngst, ob der Einsatz einer aufwendigen Blasendruckmessung bei Frauen mit anhaltender überaktiver Blase oder drangbetonter gemischter Harninkontinenz den Behandlungserfolgt verbessert.
Welche Formen der Inkontinenz gibt es?
Harninkontinenz tritt in verschiedene Formen auf: Meist handelt es sich um eine Belastungsinkontinenz bei körperlicher Anstrengung, oder um eine Dranginkontinenz mit plötzlichem übermächtigem Harndrang. Beide Formen der Inkontinenz können auch gemeinsam auftreten. Weit verbreitet ist zudem die überaktive Blase, die häufig auch als Reizblase bezeichnet wird. Betroffene haben, oft verbunden mit einer Dranginkontinenz, ständig das Gefühl, auf die Toilette zu müssen – auch wenn die Blase nicht voll ist.
Wie wird eine Harninkontinenz abgeklärt?
Zur Abklärung einer Harninkontinenz gehört neben einer genauen Befragung (Anamnese), zunächst eine körperliche Untersuchung. Außerdem werden zur Diagnostik eine Urinuntersuchung und eine Ultraschalluntersuchung der Harnblase, der Harnröhre und meist auch der Nieren durchgeführt. Die Patient:innen erstellen zudem ein Miktions- und Trinkprotokoll (Miktion = Harnlassen).
Zusätzlich können gegebenenfalls eine Röntgenuntersuchung der Harnblase, eine Blasenspiegelung oder eben eine Blasendruckmessung wichtige Informationen für die Diagnose und zur Planung der Behandlung liefern.
Was ist eine Blasendruckmessung?
Die Blasendruckmessung wird auch Urodynamische Messung oder Urodynamik genannt. Mithilfe dieser Untersuchung wird der Ablauf der Blasenentleerung, die Steuerung der Blase durch die Nerven und der während des Wasserlassens herrschende Druck in der Harnblase gemessen. Dafür wird ein dünner Blasenkatheter in die Harnblase eingeführt und gleichzeitig ein dünner Ballonkatheter im Enddarm platziert. Da Instrumente in den Körper eingeführt werden, zählt die Urodynamik zu den „invasiven“ diagnostischen Verfahren. Die Untersuchung kann als unangenehm empfunden werden, ist aber nicht schmerzhaft.
Studie untersuchte die Wirksamkeit von Blasendruckmessungen
Die schottische FUTURE-Studie untersuchte nun, ob der Einsatz dieser invasiven Untersuchungsmethode den Behandlungserfolg bei Frauen mit anhaltend überaktiver Blase oder einer drangbetonten gemischten Harninkontinenz verbessert, oder vermeidbar ist.
Die Studie wurde an 63 britischen Kliniken durchgeführt und schloss 1.099 Patientinnen ein. Sie alle hatten nicht auf konservative (nicht-operative) Behandlungen, wie Lebensstiländerungen oder medikamentöse Therapien, angesprochen und kamen für invasive Behandlungsmethoden, wie die Injektion von Botulinumtoxin A in die Blasenwand, infrage.
Bei allen Studienteilnehmerinnen wurde eine umfassende klinische Beurteilung mittels Fragebogen, körperlicher Untersuchung, Blasentagebuch, Urinanalyse und Restharnmessung (CCA) durchgeführt. Sie wurden in zwei Gruppen aufgeteilt. In der einen Gruppe wurde zusätzlich eine urodynamische Untersuchung durchgeführt, in der anderen Gruppe nicht.
Ergebnis: Die invasive Untersuchung zeigt sich nicht überlegen
Nach einer Beobachtungszeit von 15 bis 24 Monaten wurden die Teilnehmerinnen zum Behandlungserfolg befragt. Das Ergebnis zeigte keinen signifikanten Unterschied zwischen den beiden Untersuchungsmethoden: 23,6 Prozent der Frauen in der Gruppe mit Urodynamik plus CCA berichteten von einer deutlichen Besserung ihrer Symptome gegenüber 22,7 Prozent in der Gruppe mit ausschließlicher CCA.
Patientinnen, die sich ausschließlich einer CCA unterzogen hatten, berichteten zudem von einer früheren Besserung ihrer Symptome, da sie nicht auf einen Termin für eine urodynamische Messung warten mussten, sondern ohne Verzögerung behandelt werden konnten.
Fazit
Die Studienautoren schlussfolgern, dass in der untersuchten Patientinnengruppe allein umfassende klinische Untersuchungen ausreichende Informationen liefern, um einen erfolgreichen Behandlungsplan zu erstellen und Ärzt:innen folglich bei der Überweisung zu einer Urodynamik deutlich selektiver vorgehen können. Damit würde eine frühere Verbesserung der Lebensqualität, die Vermeidung invasiver Untersuchungen sowie Kosteneinsparungen im Gesundheitssystem möglich.
Weiterführende Informationen:
Weiterführende Informationen über Harninkontinenz, die überaktive Blase sowie Empfehlungen für den Alltag mit überaktiver Blase finden Sie unter den folgenden Links hier auf der Website der Urlogischen Stiftung Gesundheit.:
https://urologische-stiftung-gesundheit.de/ratgeber/harninkontinenz/
https://urologische-stiftung-gesundheit.de/ratgeber/ueberaktive-blase/
https://urologische-stiftung-gesundheit.de/besser-leben-mit-ueberaktiver-blase/
Auch die Deutsche Kontinenz Gesellschaft informiert ausführlich über Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten der überaktiven Blase:
https://www.kontinenz-gesellschaft.de/fuer-patienten/ursachen/ueberaktive-blase/
Quelle: Abdel-Fattah M et al. Invasive urodynamic investigations in the management of women with refractory overactive bladder symptoms (FUTURE) in the UK: a multicentre, superiority, parallel, open-label, randomised controlled trial