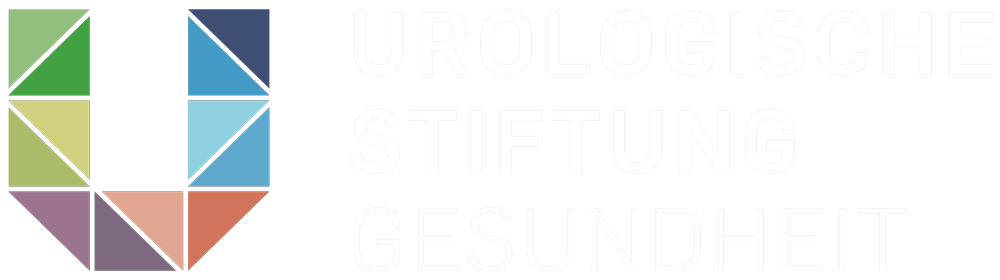Die retroperitoneale Fibrose, auch als Morbus Ormond bekannt, ist eine Erkrankung, bei der sich entzündlich verändertes, derbes Bindegewebe im hinteren Bauchraum ansammelt. Dieses wächst zunehmend und umschließt sowie drückt auf die dort liegenden Organe und Blutgefäße. Besonders betroffen sind der Harnleiter, die große Bauchschlagader (Aorta) sowie die große Hohlvene. In einigen Fällen kann das Bindegewebe sogar in diese Strukturen einwachsen.
Häufigkeit und Ursachen der retroperitonealen Fibrose
Die Erkrankung tritt im Laufe des Lebens bei 1 bis 9 von 100.000 Menschen auf. Typischerweise beginnt sie zwischen dem 40. und 60. Lebensjahr.
Bei 70 % der Patienten bleibt die Ursache unklar. Experten vermuten einen Autoimmunprozess, bei dem das Immunsystem körpereigene Strukturen angreift. In den übrigen Fällen kann die retroperitoneale Fibrose durch bestimmte Medikamente, Infektionen wie Tuberkulose, eine vorherige Bestrahlung, Blutung oder Operation in diesem Bereich ausgelöst werden. Zudem tritt sie manchmal in Verbindung mit anderen autoimmunbedingten Erkrankungen auf.
Symptome der retroperitonealen Fibrose
Sobald die Bindegewebsmasse eine gewisse Größe erreicht, können Betroffene unter Rücken- oder Flankenschmerzen leiden. Auch ein allgemeines Krankheitsgefühl sowie Gewichtsverlust können auftreten.
Wird der Harnleiter von außen abgedrückt, kann der Urin nicht mehr aus der Niere in die Blase abfließen, was einen Harnstau verursacht. Bleibt dieser über längere Zeit bestehen, kann es zusätzlich zu Flankenschmerzen auch zu einem Nierenversagen kommen.
Wird die große Bauchschlagader (Aorta) zu stark komprimiert, kann dies eine Durchblutungsstörung der Beine hervorrufen, die sich durch Schmerzen bei Bewegung bemerkbar macht. Eine Abdrückung der großen Hohlvene hingegen kann zu Wassereinlagerungen in den Beinen sowie zu Krampfadern führen.
Diagnose: Bildgebende Verfahren und Laboruntersuchungen
Zur Bestätigung der Diagnose werden Blutuntersuchungen durchgeführt. Dabei können erhöhte Entzündungswerte oder veränderte Nierenwerte Hinweise auf die Erkrankung geben.
Ein Ultraschall dient dazu, die Nieren auf einen Harnstau zu untersuchen. Eine Computertomografie (CT) oder Magnetresonanztomografie (MRT) ermöglicht eine detaillierte Darstellung der Bindegewebsmasse. Zudem hilft sie, einen Tumor als mögliche Ursache auszuschließen, da dieser ein ähnliches Krankheitsbild verursachen kann.
In bestimmten Fällen kann dennoch eine Gewebeentnahme (Biopsie) erforderlich sein, um die retroperitoneale Fibrose eindeutig festzustellen.
Behandlung der retroperitonealen Fibrose
Ein Harnstau der Nieren sollte umgehend behandelt werden, um die Nierenfunktion zu erhalten. Dazu können Harnleiterschienen oder ein Nierenfistelkatheter eingesetzt werden, um den Urinabfluss zu ermöglichen.
Die Erkrankung selbst wird mit Kortison und Immunsuppressiva wie Azathioprin behandelt, um die Immunreaktion des Körpers zu unterdrücken. Ziel der Therapie ist es, die Entzündung zu bremsen, das Wachstum des Bindegewebes einzudämmen und so die Symptome zu lindern.
Zusätzlich ist es wichtig, mögliche Auslöser der retroperitonealen Fibrose zu identifizieren und gezielt zu behandeln.
Falls die medikamentöse Therapie nicht erfolgreich ist, besteht die Möglichkeit, die Harnleiter operativ in den eigentlichen Bauchraum zu verlagern. Dadurch werden sie vor dem Druck der Bindegewebsmasse geschützt.
Da es sich bei der retroperitonealen Fibrose um eine chronisch-rezidivierende Erkrankung handelt, sind regelmäßige ärztliche Kontrollen erforderlich.
Häufige Fragen zur retroperitonealen Fibrose
Wie wird eine retroperitoneale Fibrose festgestellt?
Die Diagnose erfolgt durch eine Kombination aus Blutuntersuchungen, Ultraschall und bildgebenden Verfahren wie CT oder MRT. In einigen Fällen ist eine Gewebeentnahme (Biopsie) notwendig, um die Erkrankung eindeutig zu bestätigen.
Welche Folgen kann eine retroperitoneale Fibrose haben?
Unbehandelt kann die Erkrankung zu Nierenversagen, Durchblutungsstörungen der Beine oder Wassereinlagerungen führen. Die Beschwerden hängen davon ab, welche Organe oder Gefäße betroffen sind.
Wie wird eine retroperitoneale Fibrose behandelt?
Zur Behandlung werden Kortison und Immunsuppressiva eingesetzt, um die Entzündung zu reduzieren. Falls der Harnleiter betroffen ist, kann eine Operation notwendig sein, um den Urinabfluss sicherzustellen.