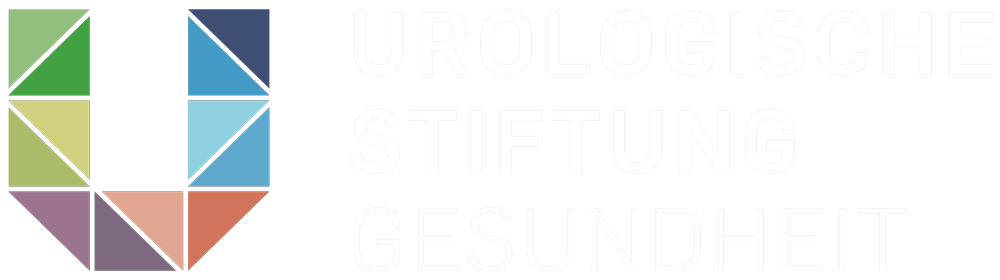Entstehung von Harnleitersteinen
Steine bilden sich im Nierenbeckenkelchsystem der Nieren (Nephrolithiasis) und können von dort in den Harnleiter gelangen (Ureterolithiasis). Es gibt verschiedene Steinarten (z.B. den häufigen Calciumoxalatstein und den seltenen, sehr harten Zystinstein), die jeweils unterschiedliche Ursachen haben.
Symptome der Harnleiterkolik
Eine Harnleiterkolik ist durch einen plötzlich eintretenden, periodisch auftretenden, krampfartigen Schmerz charakterisiert. Befindet sich der Stein noch in oder nahe der Niere, entstehen Flankenschmerzen. Ist der Stein bereits weiter durch den Harnleiter auf dem Weg zur Blase, so bemerkt der Patient zusätzlich eine Schmerzausstrahlung in den Unterbauch. Bei einem Stein, der kurz vor der Blase sitzt, können sich zusätzlich Schmerzen im Bereich des Hodensacks beim Mann und im Bereich der großen Schamlippen der Frau bemerkbar machen.
Möglicherweise muss der Patient häufiger kleinere Portionen Urin ablassen. Neben den Schmerzen können Übelkeit und Erbrechen auftreten.
Schmerztherapie bei Harnleiterkolik
Wichtig ist, dass der Patient zügig eine Schmerztherapie erhält. Hierbei wird meist eine Kurzinfusion mit Metamizol verwendet. Reicht dies nicht aus, werden zusätzlich Opiate verabreicht.
Diagnostik und erste Untersuchungen
Um ein Steinleiden festzustellen, wird zuerst der Urin untersucht und ein Ultraschall der Harnorgane gemacht. Hierbei wird nach einem Stein und einem Harnstau der Nieren gesucht. Letzterer entsteht, wenn der Urin aufgrund eines Steins im Harnleiter nicht abfließen kann. Üblicherweise wird auch eine Blutentnahme mit Bestimmung u.a. der Nierenwerte durchgeführt.
Notwendigkeit einer Harnleiterschiene oder Nephrostomie
In bestimmten Fällen ist eine zeitnahe Anlage einer Harnleiterschiene (Mono-J- bzw. Doppel-J-Schiene) oder eines Nierenfistelkatheters (Nephrostomie) notwendig, z.B. wenn der Patient trotz Schmerzmittel nicht beschwerdefrei wird, der Nierenwert im Blut (Kreatinin) sehr hoch ist oder der Harnstau in der Niere mit Keimen besiedelt ist und der Patient Fieber entwickelt. Hier besteht die Gefahr einer Blutvergiftung mit Funktionseinschränkung der Niere, so dass umgehend gehandelt werden muss.
Weiterführende Diagnostik mittels Computertomografie
Im weiteren Verlauf wird eine Computertomografie des Bauchs ohne Kontrastmittel durchgeführt, um Anzahl, Größe, Lokalisation und mögliche Komplikationen der Steine zu untersuchen. Anhand dieses Befundes wird gemeinsam über die weitere Therapie entschieden. Je nach Anzahl, Größe und Lokalisation des Steins/der Steine und den Patienteneigenschaften kommen folgende Behandlungsverfahren in Betracht:
- Konservatives Vorgehen (Zuwarten und regelmäßige Kontrollen)
- Medikamentöse Auflösung von Harnsteinen (Chemolitholyse)
- Stoßwellentherapie (Extrakorporale Stoßwellenlithotripsie, ESWL)
- Harnleiterspiegelung (Ureterorenoskopie, URS)
- Perkutane Steinentfernung (Perkutane Nephrolithotomie, PCNL)
- Offene Steinoperation (heutzutage selten)
Steinanalyse und Metaphylaxe
Wird Steinmaterial in einem der o.g. Verfahren gewonnen, kann eine Steinanalyse durchgeführt werden, in der die Steinart definiert wird. Anhand dieser Analyse und weiterer Parameter kann bestimmt werden, ob ein Patient ein niedriges oder erhöhtes Risiko hat, erneut an einem Steinleiden zu erkranken. Bei niedrigem Risiko reichen allgemeine Maßnahmen zur Vorbeugung einer erneuten Steinbildung (Metaphylaxe), wie z.B. eine Trinkmenge von 2,5-3 Litern pro Tag, eine ausgewogene, ballaststoffreiche Ernährung und körperliche Aktivität. Bei erhöhtem Risiko wird eine erweiterte Abklärung mittels u.a. Urin- und Blutuntersuchungen empfohlen, die je nach Ergebnis noch zu weiteren speziellen Empfehlungen führt.