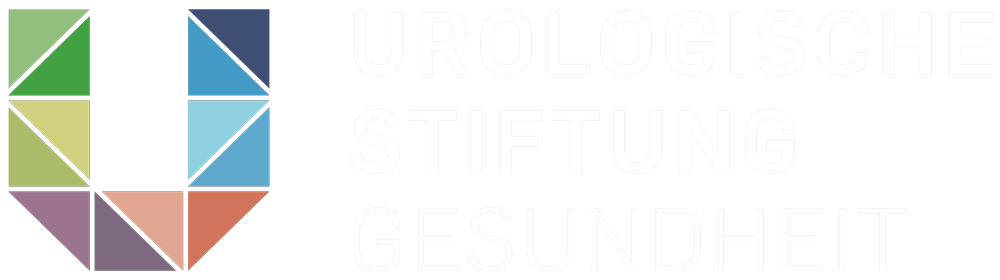Bei Tumorerkrankungen der Niere unterscheidet man zwischen Tumoren des Nierenbeckens (Urothelkarzinom) und Tumoren des Nierengewebes (Nierenzellkarzinom)selbst. Während Tumore des Nierenbeckens aus der Schleimhaut des Hohlsystems hervorgehen und Ähnlichkeiten mit Blasenkrebs aufweisen, entstehen Tumore des Nierengewebes durch Veränderungen der kleinsten Funktionseinheit der Niere – den sogenannten Nephronen. Gutartige Nierentumore sind insgesamt selten.
Diese Zusammenfassung erläutert Beschwerden, Untersuchungsmethoden sowie Behandlungsmöglichkeiten für Tumore des Nierengewebes, welche rund 90 % aller Nierenkrebserkrankungen ausmachen.
Häufigkeit von Nierenkrebs
Nierenkrebs stellt die dritthäufigste urologische Tumorerkrankung dar und macht insgesamt 2–3 % aller Krebserkrankungen in der Bevölkerung aus. In den vergangenen Jahrzehnten wurde in Europa ein jährlicher Anstieg der Krankheitsfälle um etwa 2 % verzeichnet. Männer erkranken etwa 1,5-mal häufiger als Frauen. Der Altersgipfel liegt zwischen dem 60. und 70. Lebensjahr.
Risikofaktoren für Nierenkrebs
Gesicherte Risikofaktoren für die Entstehung von Nierenkrebs sind nach aktuellem medizinischem Stand Rauchen, Übergewicht und Bluthochdruck. Zudem können familiäre Häufungen auftreten. Die effektivste Präventionsmaßnahme besteht darin, auf das Rauchen zu verzichten und ein gesundes Körpergewicht zu halten.
Symptome – Woran erkennt man Nierenkrebs?
In den meisten Fällen wird ein Nierentumor zufällig bei einer Ultraschalluntersuchung der Nieren durch den Hausarzt oder Urologen entdeckt. Ebenso können kleine Nierentumore im Rahmen einer CT-Untersuchung des Bauchraums als Zufallsbefund sichtbar werden.
Während kleinere Nierentumore in einem frühen Stadium meist keinerlei Beschwerden verursachen, können größere Tumore Symptome wie Flankenschmerzen, Blut im Urin oder einen ungewollten Gewichtsverlust hervorrufen. In fortgeschritteneren Stadien kann Nierenkrebs durch Knochenschmerzen aufgrund von Metastasen auffällig werden.
Diagnostik bei Verdacht auf Nierenkrebs
Neben den grundlegenden Untersuchungen – körperliche Untersuchung, Ultraschall, Urinuntersuchung und Blutentnahme – ist eine bildgebende Diagnostik des Bauchraums und insbesondere der Nieren essenziell. Das diagnostische Verfahren der Wahl ist eine CT-Untersuchung des Abdomens mit Kontrastmittel. In speziellen Fällen kann auch eine MRT-Untersuchung der Nieren erforderlich sein.
Zusätzlich werden CT-Aufnahmen des Brustkorbes durchgeführt, um mögliche Metastasen zu erkennen. Bei Verdacht auf Knochen- oder Hirnmetastasen können weitere Untersuchungen wie eine Knochenszintigraphie oder ein MRT des Schädels notwendig sein. Bestehen keine Anhaltspunkte für Metastasen in diesen Bereichen, kann auf diese Untersuchungen verzichtet werden.
Aktuell kann selbst mit der besten Bildgebung nicht sicher zwischen einer gutartigen oder bösartigen Geschwulst – beispielsweise einem Onkozytom – unterschieden werden. In ausgewählten Fällen kann daher eine Feinnadelbiopsie sinnvoll sein, um Informationen zur Bösartigkeit sowie zur spezifischen Unterform des Nierenkrebses zu gewinnen. Dies gilt insbesondere für kleine Tumoren, die im Rahmen einer Active-Surveillance-Strategie beobachtet werden sollen. Auch vor einer geplanten Ablationstherapie (z. B. Thermoablation) kann eine Biopsie hilfreich sein. Allerdings gibt es keine allgemeine Empfehlung, routinemäßig eine Biopsie vor einer geplanten Operation durchzuführen.
Bei fortgeschrittenem, metastasiertem Nierenkrebs kann eine Feinnadelbiopsie ebenfalls nützlich sein, um den Tumoruntertyp zu bestimmen und eine zielgerichtete medikamentöse Therapie zu ermöglichen.
Therapieoptionen bei Nierenkrebs
Die Wahl der optimalen Behandlung hängt von mehreren Faktoren ab: der Größe und Lage des Tumors, dem Gesundheitszustand des Patienten, dem Alter sowie der Ausbreitung des Tumors im Körper. Der behandelnde Urologe wird die beste individuelle Therapieoption gemeinsam mit dem Patienten besprechen.
Operation als häufigste Behandlungsform
Die chirurgische Entfernung des Tumors ist die häufigste Therapieform. Hierbei unterscheidet man zwischen der teilweisen Entfernung der tumortragenden Niere (Nierentumorenukleation oder Nierenteilresektion) und der vollständigen Entfernung der betroffenen Niere (radikale Tumornephrektomie).
Welche Operationsmethode gewählt wird, hängt von der Tumorgröße, seiner Lage und der Nierenfunktion ab. Bei kleineren Tumoren wird eine Nierentumorenukleation angestrebt, um gesundes Nierengewebe zu erhalten. Ist der Tumor größer oder ungünstig gelegen, kann eine vollständige Entfernung der tumortragenden Niere notwendig sein.
Chirurgisch stehen minimalinvasive „Schlüsselloch-Techniken“ (Laparoskopie oder robotische Chirurgie) sowie die offene Operation zur Verfügung. Auch nach der vollständigen Entfernung einer Niere kann die verbliebene gesunde Niere die Funktion meist vollständig übernehmen.
Alternativen zur Operation
Für ältere Patienten oder Patienten mit schwerwiegenden Begleiterkrankungen muss ein operativer Eingriff nicht immer die beste Option sein.
Eine Alternative stellt bei kleinen Tumoren das „Active-Surveillance“-Verfahren dar, bei dem regelmäßige Kontrolluntersuchungen (CT oder Ultraschall) durchgeführt werden und eine Therapie erst bei signifikanter Größenzunahme des Tumors eingeleitet wird. Dies beruht auf der Erkenntnis, dass kleine Tumoren bei älteren Patienten oft eine geringe Metastasierungswahrscheinlichkeit haben.
Experimentelle Verfahren wie Mikrowellen-Ablation, Laser-Ablation oder High-Intensity-Ultraschall sind derzeit nur im Rahmen von Studien zu empfehlen. In sehr fortgeschrittenen Fällen kann ein rein palliativer Behandlungsansatz erwogen werden.
Behandlung fortgeschrittener Tumorstadien
Werden bei der Diagnose bereits Metastasen festgestellt, kann die Entfernung des ursprünglichen Nierentumors den Krankheitsverlauf möglicherweise positiv beeinflussen. Sollten später einzelne, chirurgisch entfernbarer Metastasen auftreten, kann eine Operation dieser Metastasen durchgeführt werden.
Die Entscheidung für eine Operation bei metastasiertem Nierenkrebs wird interdisziplinär getroffen, unter Einbeziehung von Spezialisten verschiedener Fachrichtungen (z. B. Thoraxchirurgie, Strahlentherapie, Onkologie).
In weiter fortgeschrittenen Stadien stehen medikamentöse Therapieoptionen zur Verfügung. Eine Strahlentherapie kann zudem Schmerzen durch Knochenmetastasen lindern oder Beschwerden durch Hirnmetastasen verbessern.
Medikamentöse Therapie bei Nierenkrebs
Hat sich Nierenkrebs im Körper bereits durch Metastasen ausgebreitet, kann eine medikamentöse Therapie mit Immuntherapeutika zum Einsatz kommen. Eine klassische Chemotherapie zeigt beim Nierenkrebs hingegen keine Wirkung.
Die Wahl der Wirkstoffe richtet sich nach dem histologischen Tumorbefund und individuellen Risikofaktoren. Da Nebenwirkungen auftreten können, sollte die Therapie durch erfahrene Urologen oder Onkologen durchgeführt werden.
Nachsorge bei Nierenkrebs
Regelmäßige Nachsorgeuntersuchungen beim Urologen sind essenziell, um die Nierenfunktion zu kontrollieren und ein mögliches Wiederauftreten des Krebses frühzeitig zu erkennen. Dazu gehören auch CT-Untersuchungen des Brustkorbs und Bauchraums. Ein einheitlicher Nachsorgestandard existiert jedoch nicht.
Häufige Fragen zu Nierenkrebs
Wie häufig tritt Nierenkrebs auf?
Nierenkrebs ist eine der häufigeren urologischen Tumorerkrankungen und macht etwa 2–3 % aller Krebsfälle aus. Männer sind etwa 1,5-mal häufiger betroffen als Frauen.
Welche Symptome verursacht Nierenkrebs?
Frühe Stadien verlaufen oft symptomlos, größere Tumore können jedoch Flankenschmerzen, Blut im Urin oder Gewichtsverlust verursachen. Knochenschmerzen können auf Metastasen hinweisen.
Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?
Die häufigste Therapieform ist die chirurgische Entfernung des Tumors. Alternativ können in bestimmten Fällen eine medikamentöse Behandlung oder eine Überwachungsstrategie („Active Surveillance“) in Betracht gezogen werden.