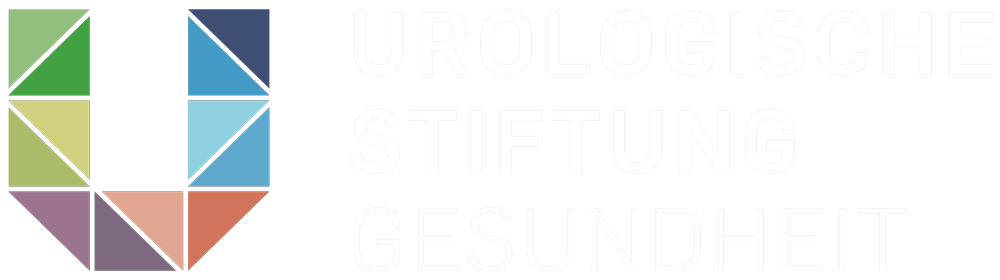Weiterführende Informationen
Einleitung
In den Nieren wird der Urin gebildet – dies geschieht durch die Filtration des Blutes. Auf diesem Weg befreit der Körper sich von überschüssiger Flüssigkeit sowie von Stoffwechselprodukten. Über die Harnleiter gelangt der Urin in die Harnblase, die als reines Speicherorgan dient. Mit der Entleerung der Harnblase wird der Urin schließlich über die Harnröhre ausgeschieden.
Unter normalen Bedingungen sind die Harnwege – von den Nieren bis zur Harnröhre (der sogenannte Harntrakt) – weitgehend frei von einer relevanten Anzahl an Bakterien. Dennoch treten Harnwegsentzündungen relativ häufig auf und können schmerzhaft sowie unangenehm sein. Diese Entzündungen können sowohl einzelne Bereiche als auch den gesamten Harntrakt betreffen.
Häufigkeit und Einteilung von Nieren- und Harnwegsentzündungen
Nieren- und Harnwegsentzündungen zählen zu den häufigsten Infektionskrankheiten. Etwa 5 von 100 Frauen leiden an einer Harnwegsentzündung.
Grundsätzlich unterscheidet man zwischen einer asymptomatischen Bakteriurie und einem floriden Harnwegsinfekt. Der Begriff asymptomatische Bakteriurie beschreibt den Nachweis von Bakterien im Urin, ohne dass diese Beschwerden verursachen. Dies tritt häufig bei Patienten mit Dauerkathetern auf, kann aber auch bei gesunden Menschen vorkommen. In den meisten Fällen ist hier keine Therapie erforderlich (siehe unten).
Ein Harnwegsinfekt hingegen äußert sich in ausgeprägten Beschwerden, die durch eine bakterielle Besiedlung der Harnwege hervorgerufen werden. Das Spektrum reicht von einer unkomplizierten Harnblasenentzündung – die unangenehm, aber ungefährlich ist – bis hin zu einer Nierenbeckenentzündung, die im schlimmsten Fall eine lebensbedrohliche Blutvergiftung nach sich ziehen kann.
Frauen sind etwa viermal häufiger betroffen als Männer. Nach einem ersten Häufigkeitsgipfel in der Kindheit treten während der Jugendzeit nur wenige Harnwegsentzündungen auf. Bei jungen, geschlechtsaktiven Frauen steigt das Infektionsrisiko jedoch wieder an. In der Schwangerschaft sind Frauen besonders gefährdet, da aus einer harmlosen Keimbesiedlung der Harnblase schnell eine ernsthafte Niereninfektion entstehen kann.
Bei Männern nimmt die Infektionshäufigkeit zwischen dem 60. und 70. Lebensjahr zu. Häufig liegt die Ursache in einer gutartigen Prostatavergrößerung (benigne Prostatahyperplasie). Durch die zunehmend unvollständige Blasenentleerung bleibt Restharn zurück, wodurch sich Bakterien schlechter ausspülen lassen und das Infektionsrisiko steigt.
Von einer unkomplizierten Harnwegsentzündung spricht man, wenn keine Harnabflussstörungen wie Harnsteine, Fehlbildungen der Harnwege oder narbige Gewebsveränderungen vorliegen. Zudem haben Patienten mit einer unkomplizierten Harnwegsinfektion definitionsgemäß keine „Rückzugsgebiete“ für Bakterien, wie sie durch Katheter, Harnsteine oder Tumoren entstehen können. Solche Rückzugsorte bieten Bakterien eine Ansiedlungsfläche, sodass sie durch den Urinfluss nicht ausgespült und auch mit Antibiotika nur schwer bekämpft werden können.
Auch eine geschwächte Immunabwehr oder bestimmte Erkrankungen wie Diabetes und Gicht können Harnwegsinfektionen begünstigen.
Eine komplizierte Harnwegsentzündung liegt vor, wenn schwerere organische Veränderungen im Harntrakt oder ausgeprägte Stoffwechselkrankheiten hinzukommen.
Patienten mit wiederkehrenden oder komplizierten Harnwegsentzündungen sollten sorgfältig vom Urologen untersucht werden. Eine besondere Patientengruppe sind diejenigen, die Symptome einer Harnwegsinfektion aufweisen, jedoch keine nachweisbare bakterielle Infektion haben. Hier können beispielsweise Tumoren, bestimmte Medikamente, Bestrahlungen oder Allergien die Ursache sein. In einigen Fällen lässt sich keine eindeutige Ursache finden – wie bei der interstitiellen Zystitis.
Beschwerden bei Nieren- und Harnwegsentzündungen
Typische Symptome einer Harnwegsinfektion sind brennende Schmerzen beim Wasserlassen, häufiger Harndrang, abgeschwächter Harnstrahl, Ausfluss aus der Harnröhre oder unkontrollierter Urinverlust. Für Patienten oft beunruhigend ist eine sichtbare Blutbeimengung im Urin, die im Rahmen der Entzündung nicht selten auftritt. Da Blut ein intensiver „Farbstoff“ ist, können bereits geringe Mengen eine deutliche Rotverfärbung des Urins verursachen – der tatsächliche Blutverlust ist jedoch meist nicht gefährlich.
Schmerzen können im Bereich des Unterbauches und der Flanken, aber auch im Damm- und Genitalbereich auftreten. Männer mit einer Prostataentzündung (Prostatitis) können zusätzlich Blutbeimengungen im Ejakulat sowie Schmerzen im Enddarmbereich haben.
Besonders wichtig sind Beschwerden, die auf eine Beteiligung der Nieren oder eine schwerere Infektion hinweisen. Dazu gehören Fieber über 38°C, Schüttelfrost, ein allgemeines Krankheitsgefühl sowie starke Flankenschmerzen – ähnlich einer Grippe. Schwere Harnwegsentzündungen können zudem mit Übelkeit und Erbrechen einhergehen. Beim Auftreten dieser allgemeinen Krankheitszeichen muss rasch der Arzt aufgesucht werden, damit sofort eine Untersuchung und Behandlung eingeleitet werden kann.
Manchmal verlaufen Harnwegsinfektionen jedoch auch völlig beschwerdefrei – dies ist bei der bereits erwähnten asymptomatischen Bakteriurie der Fall. Solche Infektionen werden meist nur zufällig bei einer Routineuntersuchung des Urins entdeckt. Besteht der Verdacht auf eine Verunreinigung der Urinprobe, sollte die Untersuchung wiederholt werden. Ist die Urinprobe jedoch korrekt und zeigt eine Entzündung ohne Symptome, wird eine Behandlung in der Regel nur bei Schwangeren oder Patienten nach Organtransplantationen empfohlen.
Ein besonderer Fall ist der wiederholte Nachweis von erhöhten Mengen weißer Blutkörperchen (Leukozyten) im Urin, ohne dass Bakterien nachweisbar sind. Hier sollte auch an eine Tuberkulose der ableitenden Harnwege gedacht werden. Obwohl Tuberkulose selten ist, muss sie als mögliche Ursache in Betracht gezogen werden. Die Diagnostik gestaltet sich hierbei schwierig und erfordert spezielle Untersuchungen des Morgenurins.
Bei allen anderen Patienten mit asymptomatischer Bakteriurie kann zunächst abgewartet werden, da diese in den meisten Fällen keine Beschwerden verursacht und sich die Bakterien häufig von selbst zurückbilden.
Untersuchung bei Verdacht auf Nieren- und Harnwegsentzündungen
Körperliche Untersuchung und Urindiagnostik
Neben der Angabe der Beschwerden durch den Patienten dient dem Arzt eine körperliche Untersuchung zur Sicherung der Diagnose.
Ein zentraler Bestandteil der Diagnostik ist die Urinuntersuchung. Der Patient gibt hierzu eine Urinprobe in einem sterilen Gefäß ab. Wichtig ist, dass bei der Gewinnung der Urinprobe Männer ihre Vorhaut zurückstreifen und Frauen die Schamlippen spreizen, um eine Verunreinigung der Probe durch Hautkeime zu vermeiden.
Zunächst lässt der Patient etwas Urin in die Toilette und fängt anschließend den Mittelstrahlurin mit dem zur Verfügung gestellten Urinbecher auf. Dabei darf die Innenseite des Bechers nicht mit den Fingern oder dem Genitalbereich in Kontakt kommen. In unklaren oder komplizierten Fällen sowie bei häufig wiederkehrenden Infektionen kann auch die Abnahme von Katheterurin erforderlich sein. Diese Methode reduziert Verunreinigungen aus dem Genitalbereich und ermöglicht eine zuverlässigere Diagnose einer Harnwegsentzündung.
Der gewonnene Urin wird anschließend mit Teststreifen und unter dem Mikroskop untersucht. Im Rahmen eines Harnwegsinfektes lassen sich dabei rote und weiße Blutkörperchen sowie Bakterien nachweisen.
Zusätzlich wird meist eine sogenannte Urinkultur angelegt. Dazu wird der zu untersuchende Urin auf einer Agarplatte verteilt – einer Plastikschale mit einem nährstoffhaltigen Gelee, auf dem Bakterien wachsen können. Diese Methode erlaubt die Bestimmung der genauen Erregerart und ihrer Empfindlichkeit gegenüber verschiedenen Antibiotika.
Bildgebende Untersuchungen: Ultraschall und Röntgen
Eine Ultraschalluntersuchung (Sonographie) der Harnwege ist sinnvoll, um Nieren und Harnblase genauer beurteilen zu können.
Dabei wird unter anderem der sogenannte Restharn mittels Ultraschall gemessen. Als Restharn bezeichnet man die Menge an Urin, die unmittelbar nach dem Wasserlassen in der Blase verbleibt. Eine gesunde Harnblase entleert sich vollständig und ist restharnfrei.
Diese Kombination aus Untersuchungsmethoden ermöglicht es in vielen Fällen, Erkrankungen wie Harnsteine, Tumoren oder Abflussstörungen des Harntraktes zu erkennen und somit eine Einteilung in komplizierte und unkomplizierte Harnwegsentzündungen vorzunehmen.
Falls der Patient bereits häufiger Harnwegsentzündungen hatte, sucht der Urologe gezielt nach Fehlbildungen oder funktionellen Störungen des Harntraktes. Ziel ist es, mögliche Ursachen für wiederkehrende Infektionen zu identifizieren und, wenn möglich, zu beheben.
Zu den weiterführenden Untersuchungsmethoden zählt eine Röntgenuntersuchung der Harnwege mit Kontrastmittel oder eine Blasenspiegelung. Solche Untersuchungen werden jedoch erst nach erfolgreicher Behandlung der akuten Infektion durchgeführt.
In speziellen Fällen können auch Abstriche aus der Harnröhre oder der Scheide notwendig sein. Bei Verdacht auf eine Prostataentzündung erfolgt beim Mann eine Prostatamassage mit anschließender Untersuchung des gewonnenen Prostatasekrets. Zusätzlich kann eine Analyse des Spermas auf Entzündungszellen und Bakterien durchgeführt werden.
Blutuntersuchungen zur Bestimmung der Entzündungswerte
Einige Blutuntersuchungen helfen, festzustellen, ob eine schwerwiegende Entzündung im Körper vorliegt. Dazu gehören die Bestimmung der weißen Blutkörperchen, die Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit und die Messung eines spezifischen Entzündungsmarkers – des C-reaktiven Proteins (CRP).
Weitere Untersuchungen
Darüber hinaus gibt es spezielle Untersuchungsmethoden zur Abklärung komplizierter oder wiederkehrender Harnwegsinfektionen:
- Harnstrahlmessung (Uroflowmetrie): Der Patient uriniert bei voller Blase in ein Messgerät, das den Harnfluss misst.
- Harnblasenfunktions-Röntgenuntersuchung (Miktionszystourographie, MCU): Die Harnblase wird mit Kontrastmittel gefüllt und unter Röntgenkontrolle entleert. Diese Methode kann einen vesiko-renalen Reflux nachweisen – also den Rückfluss von Urin aus der Blase in die Nieren, was normalerweise nicht vorkommt. Falls ein solcher Reflux besteht, kann er operativ behandelt werden.
- Ausscheidungsurographie (Nierenröntgen mit Kontrastmittel): Diese Untersuchung kann helfen, strukturelle Probleme oder Abflussstörungen in den Harnwegen zu erkennen.
- Harnröhren- und Harnblasenspiegelung (Urethrozystoskopie): Bei bestimmten Fragestellungen wird die Harnröhre und Blase endoskopisch untersucht.
Erreger bei Harnwegsentzündungen
Die meisten Harnwegsentzündungen werden durch Bakterien verursacht, insbesondere durch Stäbchen- oder Kugelbakterien wie Escherichia coli (E. coli), Klebsiella, Proteus oder Enterobacter. Diese Bakterien stammen häufig aus dem menschlichen Darm.
Bei komplizierten Harnwegsentzündungen kommen auch andere, oft gegen Antibiotika resistente Bakterien als Erreger infrage.
Wenn eine Antibiotikatherapie nicht anschlägt, müssen neben resistenten Bakterien auch andere Erreger in Betracht gezogen werden. Dazu gehören Chlamydien, Mykoplasmen, Tuberkulosebakterien, Parasiten oder Pilze. Viren spielen bei Harnwegsentzündungen hingegen keine bedeutende Rolle.
Antibiotische Therapie bei Nieren- und Harnwegsentzündungen
Wahl des Antibiotikums und Dauer der Behandlung
Für die Wahl eines geeigneten Antibiotikums sowie die Dauer der Behandlung sind bestimmte Risikofaktoren entscheidend. Dazu gehören vorangegangene Entzündungen, erhöhte Nierenblutwerte (chronisches Nierenversagen), Schwangerschaft oder Allergien.
Mitunter treten Harnwegsinfektionen auch nach ärztlichen Eingriffen in der Praxis oder im Krankenhaus auf. Bei diesen Infektionen müssen Erreger in Betracht gezogen werden, die bereits Resistenzen gegen Antibiotika tragen. Je nachdem, ob eine unkomplizierte oder komplizierte Nieren- oder Harnwegsentzündung vorliegt, entscheidet der Arzt über die Art des Medikaments (Tabletten oder Spritzen/Infusionen) sowie die Dauer der Behandlung.
Besonders wichtig ist es, die Medikamente exakt so lange einzunehmen, wie es der Arzt verordnet hat. Während unkomplizierte Harnblasenentzündungen bei Frauen nur kurzzeitig behandelt werden müssen, erfordern schwerere Infektionen eine längere Therapie. Auch wenn die Beschwerden bereits abgeklungen sind, dient die verlängerte Einnahme dazu, eine vollständige Ausheilung zu gewährleisten – insbesondere bei hartnäckigen Nierenbeckenentzündungen. Ein vorzeitiger Abbruch der Behandlung kann dazu führen, dass sich derselbe Erreger erneut vermehrt und die Beschwerden wiederkehren.
Antibiotikawahl und Resistenzentwicklung
Kein Antibiotikum kann grundsätzlich alle möglichen Erreger einer Harnwegsentzündung abtöten. Daher kann der Arzt keine Heilungsgarantie geben.
In der Regel wird vor der Behandlung eine Urinkultur angelegt, bei der bereits im Labor die Empfindlichkeit der Erreger ausgetestet wird, deren Ergebnisse jedoch erst nach etwa 2–3 Tagen vorliegen. Da viele Patienten bereits unter starken Beschwerden leiden, beginnt man häufig mit einem Antibiotikum, das mit hoher Wahrscheinlichkeit gegen den Erreger wirkt (kalkulierte Antibiose).
Sobald das Kulturergebnis vorliegt, kann die Therapie – falls notwendig – angepasst werden. Falls der Erreger resistent ist, wird das Antibiotikum gewechselt (resistenzgerechte Antibiose). Falls das ursprünglich gewählte Medikament wirksam ist, wird die Behandlung unverändert fortgesetzt.
Sollten trotz korrekter Antibiotikaeinnahme die Beschwerden nicht verschwinden, kann dies verschiedene Ursachen haben. Möglicherweise wird das Medikament nicht ausreichend aus dem Darm aufgenommen oder während der Behandlung ist eine Resistenz der Bakterien entstanden. In solchen Fällen erfolgt ein Wechsel des Antibiotikums, gegebenenfalls auch auf eine Infusions- oder Spritzenbehandlung.
Zusätzlich können unerkannte komplizierende Faktoren die Heilung behindern, sodass der Urologe weitere Untersuchungen einleiten wird.
Nebenwirkungen und Antibiotika-Allergien
Von der langen Liste möglicher Nebenwirkungen auf dem Beipackzettel sollte man sich nicht abschrecken lassen. Diese enthält auch äußerst seltene Nebenwirkungen, da deren Angabe gesetzlich vorgeschrieben ist.
Das gesundheitliche Risiko einer unzureichenden oder falschen Behandlung ist in der Regel höher als das Risiko durch potenzielle Nebenwirkungen.
In manchen Fällen muss der Patient gewisse Risiken in Kauf nehmen. Treten jedoch unerklärliche Beschwerden während der Behandlung auf, sollte unverzüglich der Arzt kontaktiert werden.
Manche Patienten glauben, sie hätten eine generelle Allergie gegen Antibiotika und könnten keine dieser Medikamente einnehmen. Es gibt jedoch viele verschiedene Antibiotikagruppen, sodass eine Unverträglichkeit gegenüber einem Medikament nicht automatisch bedeutet, dass keine andere Substanz vertragen wird.
Daher ist es wichtig, sich frühere Unverträglichkeiten genau zu merken – insbesondere Symptome wie Übelkeit, Hautausschläge oder schwere allergische Reaktionen – und diese Informationen an den Arzt weiterzugeben.
Risikopatienten und ergänzende Maßnahmen
Besondere Aufmerksamkeit benötigen Risikopatienten. Während der Schwangerschaft dürfen nur Antibiotika eingesetzt werden, die für das heranwachsende Kind unbedenklich sind. Gleiches gilt für Frauen in der Stillzeit.
Bei starken Schmerzen, beispielsweise im Rahmen einer Nierenbeckenentzündung, kann die zusätzliche Gabe von Schmerzmitteln notwendig sein.
Trotz der Beschwerden ist es wichtig, ausreichend Flüssigkeit zuzuführen. Dadurch wird der Harn verdünnt und Bakterien aus dem Harntrakt ausgespült. Zudem erschwert verdünnter Urin den Bakterien das Überleben.
Empfohlen werden Wasser sowie Frucht- und Blättertees. Dagegen sollten Kaffee, schwarzer Tee und Alkohol gemieden werden.
Behandlung akuter Harnwegsentzündungen
Einfache, unkomplizierte Harnblasenentzündung
Eine unkomplizierte Harnblasenentzündung bei Frauen kann mit einer Einmal- oder Kurzzeittherapie über drei Tage behandelt werden. Der Arzt wählt dabei das am besten geeignete Antibiotikum aus.
Die Erfolgsquoten liegen – je nach Medikament – zwischen 80 % und 100 %. Falls bestimmte Risikofaktoren vorliegen (siehe unten), sollte die Therapie länger durchgeführt werden.
Ein Vorteil der Kurzzeittherapie besteht in der geringeren Gefahr einer Resistenzentwicklung. Zudem treten weniger Nebenwirkungen auf.
Zu beachten ist, dass auch nach Einnahme des Antibiotikums die Beschwerden noch zwei bis drei Tage anhalten können, da die Entzündungsreaktion des Körpers nur langsam abklingt.
Bleibt der Therapieerfolg trotz empfindlicher Erreger aus, sollte überprüft werden, ob das Medikament korrekt eingenommen wurde. Zudem muss nach komplizierenden Faktoren oder einer Beteiligung der Nieren gesucht werden.
Risikofaktoren für ein Therapieversagen:
- Vorausgegangene Harnwegsentzündungen
- Verwendung von Vaginalpessaren oder spermiziden Substanzen zur Verhütung
- Hohe Bakterienzahl im Urin (> 1.000.000/ml)
Harnwegsinfektionen bei Männern eignen sich nicht für eine Einmal- oder Kurzzeittherapie. Hier ist eine längere Behandlungsdauer erforderlich. Zudem sollte der Urologe nach möglichen Ursachen wie einer gutartigen Prostatavergrößerung suchen.
Unkomplizierte Nierenbeckenentzündung (Pyelonephritis)
Eine unkomplizierte Nierenbeckenentzündung erfordert eine Antibiotikatherapie über 7–14 Tage. In den meisten Fällen kann die Behandlung ambulant mit Tabletten erfolgen.
Schwere und komplizierte Harnwegsentzündungen
Bei schweren Infektionen mit hohem Fieber, Übelkeit, Erbrechen und Kreislaufproblemen wird der Arzt zu Beginn meist eine Antibiotikatherapie per Infusion verabreichen.
In diesen Fällen können auch Medikamentenkombinationen erforderlich sein. Eine zumindest vorübergehende stationäre Behandlung kann notwendig werden. Sobald sich der Zustand bessert, erfolgt die Weiterbehandlung mit Tabletten.
In besonders schweren Fällen kann eine längere Therapiedauer notwendig sein. Falls sich Eiter in der Prostata oder Niere ansammelt, kann in Einzelfällen eine chirurgische Behandlung erforderlich werden.
Bei einer Harnstauung in der Niere – zum Beispiel durch einen eingeklemmten Harnleiterstein mit begleitender bakterieller Infektion – kann eine zeitnahe Anlage einer Harnleiterschiene notwendig sein.
Allgemeine Maßnahmen zur Vorbeugung von Harnwegsentzündungen
Vorbeugung wiederkehrender Harnwegsinfektionen
Trotz der guten Behandlungsmöglichkeiten für akute Harnwegsentzündungen sowie der Möglichkeit, einige Ursachen operativ oder medikamentös zu beseitigen, leiden etwa 20 % der Patienten – insbesondere Frauen – unter wiederkehrenden (rezidivierenden) Harnwegsinfektionen.
Mit den gängigen Untersuchungsmethoden lässt sich in diesen Fällen oft keine eindeutige Ursache feststellen, die sich gezielt beseitigen ließe. Daher sollten zunächst die folgenden vorbeugenden Maßnahmen beachtet werden, die in der nachstehenden Liste zusammengefasst sind.
Ein häufiger Fehler bei wiederkehrenden Harnwegsentzündungen ist die bewusste Reduzierung der Trinkmenge, um Schmerzen und häufiges Wasserlassen zu vermeiden. Dies ist jedoch ungünstig, da Bakterien sich in verdünntem Urin schlechter vermehren können. Darüber hinaus führt eine vermehrte Flüssigkeitsaufnahme dazu, dass die Blase häufiger entleert wird, wodurch eingedrungene Erreger mechanisch ausgespült werden. Deshalb sollte eine tägliche Trinkmenge von etwa 2 Litern angestrebt werden. Patienten mit schweren Herz- oder Nierenerkrankungen sollten die optimale Flüssigkeitszufuhr mit ihrem behandelnden Arzt abstimmen.
Langzeitvorbeugung mit Antibiotika
Bereits seit etwa 40 Jahren ist die vorbeugende (prophylaktische) Behandlung mit niedrig dosierten Antibiotika zur Verhinderung von Harnwegsinfektionen etabliert.
Diese Methode zielt darauf ab, die lange nächtliche Urinspeicherphase mit wirksamen Antibiotikaspiegeln im Urin zu überbrücken. Dadurch wird verhindert, dass eingedrungene Erreger die lange Verweildauer des Harns in der Blase für ihre Vermehrung nutzen.
Kontrollierte Untersuchungen haben gezeigt, dass bestimmte Antibiotika für diese Langzeitprophylaxe geeignet sind. Die Einnahme erfolgt täglich abends nach dem letzten Wasserlassen für einen Zeitraum von drei Monaten bis zu einem Jahr. Dabei wird lediglich ein Viertel bis ein Sechstel der üblichen Dosis verabreicht, die für die Behandlung einer akuten Harnwegsentzündung eingesetzt werden würde.
Besonders bewährt haben sich die Wirkstoffe Trimethoprim, Nitrofurantoin und in bestimmten Fällen auch Norfloxacin.
Neben der täglichen Einnahme von Antibiotika gibt es alternative Ansätze:
- Einmalige Antibiotikagabe nach dem Geschlechtsverkehr als vorbeugende Maßnahme
- Selbstbehandlung mit Antibiotika bei ersten Beschwerden in ausgewählten Fällen
Diese Strategien sollten jedoch immer mit dem behandelnden Arzt abgestimmt werden.
Unter der Langzeitprophylaxe treten nur sehr selten sogenannte „Durchbruchsinfektionen“ auf. Entscheidend für den Erfolg ist die konsequente Einnahme der Medikamente nach ärztlicher Vorgabe, um einen durchgehenden Schutz zu gewährleisten.
In Kombination mit einer eingehenden Beratung kann eine Langzeittherapie bei den meisten Frauen das Auftreten von Harnwegsinfektionen deutlich reduzieren oder sogar vollständig verhindern.
Abschließende Bemerkungen
Alle Nieren- und Harnwegsentzündungen sollten sorgfältig daraufhin untersucht werden, welche Form der Infektion vorliegt. Diese Aufgabe übernimmt der Urologe, der durch intensive Gespräche mit dem Patienten sowie gezielte Untersuchungen die bestmögliche Therapie bestimmt.
Je nach Befund werden geeignete Medikamente zur Behandlung akuter Beschwerden verordnet. Falls erforderlich, können zusätzliche urologische Untersuchungs- oder Behandlungsmethoden notwendig sein.
Bei häufig wiederkehrenden Infektionen (Rezidiven) erfolgt eine ausführliche Beratung zu möglichen vorbeugenden Maßnahmen. Falls nötig, kann eine Langzeittherapie angeboten werden, um das Risiko unangenehmer und wiederkehrender Entzündungen zu verringern.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Wie äußert sich eine Harnwegsinfektion?
Typische Symptome sind Schmerzen beim Wasserlassen, häufiger Harndrang und ein abgeschwächter Harnstrahl. In schweren Fällen können Fieber, Flankenschmerzen oder Übelkeit auftreten.
Welche Faktoren begünstigen eine Harnwegsinfektion?
Risikofaktoren sind unter anderem eine unvollständige Blasenentleerung, eine geschwächte Immunabwehr sowie bestimmte Grunderkrankungen wie Diabetes. Auch Schwangerschaft und die Verwendung von Kathetern erhöhen das Risiko.
Wann sollte ein Arzt aufgesucht werden?
Ein Arztbesuch ist ratsam, wenn die Beschwerden länger als drei Tage anhalten oder Fieber, Schüttelfrost und starke Schmerzen auftreten. Besonders Schwangere, Männer und Patienten mit Vorerkrankungen sollten frühzeitig medizinische Hilfe in Anspruch nehmen.
Wie wird eine Harnwegsinfektion diagnostiziert?
Die Diagnose erfolgt durch eine Kombination aus Urinuntersuchungen, Teststreifen, Mikroskopie und einer Urinkultur. Bei wiederkehrenden oder komplizierten Infektionen können zusätzlich bildgebende Verfahren wie Ultraschall oder Röntgen notwendig sein.
Wann sind weiterführende Untersuchungen wie eine Blasenspiegelung notwendig?
Eine Blasenspiegelung wird bei wiederkehrenden Harnwegsinfektionen oder Verdacht auf anatomische Fehlbildungen und Tumoren durchgeführt. Sie erfolgt erst, nachdem eine akute Entzündung erfolgreich behandelt wurde.
Wie wird eine Harnwegsinfektion diagnostiziert?
Die Diagnose erfolgt durch eine Kombination aus Urinuntersuchungen, Teststreifen, Mikroskopie und einer Urinkultur. Bei wiederkehrenden oder komplizierten Infektionen können zusätzlich bildgebende Verfahren wie Ultraschall oder Röntgen notwendig sein.
Warum ist die Gewinnung von Mittelstrahlurin wichtig?
Mittelstrahlurin reduziert die Verunreinigung der Probe durch Bakterien aus dem Genitalbereich. Dadurch lässt sich eine Harnwegsinfektion zuverlässiger nachweisen.
Warum muss man Antibiotika bei Harnwegsinfektionen so lange einnehmen?
Selbst wenn die Beschwerden bereits abgeklungen sind, soll durch die längere Einnahme eine vollständige Beseitigung der Erreger sichergestellt werden. Ein vorzeitiger Abbruch erhöht das Risiko eines Rückfalls.
Kann eine Harnwegsinfektion von selbst ausheilen?
In einigen Fällen kann das Immunsystem eine leichte Infektion selbst bekämpfen. Bei stärkeren Symptomen oder Risikofaktoren sollte jedoch immer eine antibiotische Behandlung erfolgen.
Welche Rolle spielt die Flüssigkeitszufuhr bei der Behandlung?
Eine hohe Flüssigkeitszufuhr verdünnt den Urin und hilft, Bakterien aus den Harnwegen auszuspülen. Dadurch wird das Überleben der Erreger erschwert.
Wie kann man Harnwegsinfektionen wirksam vorbeugen?
Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr, regelmäßige Blasenentleerung und eine gute Intimhygiene sind wichtige Maßnahmen. In bestimmten Fällen kann eine antibiotische Langzeitprophylaxe sinnvoll sein.
Warum ist es wichtig, genügend zu trinken?
Eine erhöhte Flüssigkeitsaufnahme verdünnt den Urin und sorgt dafür, dass eingedrungene Bakterien schneller ausgeschieden werden. Dies verringert das Risiko einer Infektion.
Wann sollte eine Langzeittherapie mit Antibiotika in Betracht gezogen werden?
Bei häufig wiederkehrenden Harnwegsinfektionen, die durch andere Maßnahmen nicht verhindert werden können, kann eine langfristige antibiotische Prophylaxe helfen. Dies sollte jedoch immer mit einem Arzt besprochen werden.